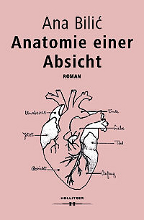Als wäre dieser Text eine klassische Exemplifizierung der Goethe’schen Novellentheorie, lässt Bilic ihre Leserinnen und Leser mit dem ersten Satz mitten in der Geschichte zurück, in einer Beziehungskonstellation, wie sie alltäglicher nicht sein kann – nur, dass jene unerhörte Begebenheit sich eben noch nicht ereignet hat, noch die Absicht, nicht die Tat regiert. Ausgerechnet mit Pilzen, Helmuts Lieblingsgericht, beabsichtigt Lidia ihren Ehemann zu töten, allerdings wird sie ihm keine Schirmpilze, sondern die tödlichen Knollenblätterpilze zubereiten. „Nein, ich bin ihm nicht böse und es gibt keinen Grund, ihn zu töten. Aber trotzdem töte ich ihn.“ (S.9)
Trotzdem, weil Lidia jahrelang von ihrem Mann gedemütigt, beleidigt und verachtet wurde, weil aus dem Ungleichgewicht zwischen dem älteren, reichen Steuerberater und der jüngeren, hübschen Übersetzerin ein Machtgefälle zwischen einem alles bestimmenden, über alle bestimmenden Helmut und einer sich fügenden, leidenden Lidia wurde, weil der Schutzschirm des Geschäftsmannes sich in ein Gefängnis für die Tschechin verwandelte. Distanziert, emotionslos und kühl legt Lidia ihre Absicht dar, erläutert die Gründe dafür und identifiziert als auslösendes Moment eine, gemessen an ihrem Leiden, nebensächliche Episode: „Und für mich waren in dieser Liebe ein Nervenzusammenbruch, Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle und Alkoholismus inkludiert.“ (S.59)
Und Helmut: er gesteht seinem Freund Bernd, dass er sich die Affäre mit Elisabeth nur ausgedacht hatte, „um ihr zu zeigen, dass sie ihre Leidenschaft nicht zu meinen Lasten beleben darf.“ (S.77) Er hält sich für einen Beschützer, der aus dem „braven Mädchen“ eine Frau geformt habe, ihr jedoch die Fähigkeit, sich um ein Kind zu kümmern abspricht und daher auch Nachkommen verweigert, und der vom „einfachen, altmodischen Sex“ mit der Philippinerin Schascha schwärmt, „wo die Frau den Mann bedient“ (S.79). Lidia habe nur die Rolle der reichen Hausfrau zu spielen („Wenn mir jemand Geld anbieten würde, um zu Hause zu bleiben, lang zu schlafen und mich den ganzen Tag zu langweilen, hätte ich nichts dagegen.“ (S.74). Beziehungen hält er für Investment.
Ganz ähnlich dürfte dies Vojadin, der Ehemann von Lidias Putzfrau Ljuba sehen, der gegenüber seiner Frau und seinem Sohn Dragan nicht nur psychische, sondern auch physische Gewalt ausübt, sie mit Schlägen und Prügel unter Kontrolle hält. Hier wie da, Lidia und Ljuba, erdulden und leiden, setzen sich nicht zur Wehr, suchen die Schuld im eigenen Verhalten. Was der einen die übergroße anfängliche Liebe, ist der anderen die Adventistenkirche, die eine Scheidung verbietet. Ausflüchte, Erklärungen, Beschwichtigungen, die an das Selbst gerichtet sind, nichts mehr als ein Bewahren der Fassade des eigenen Gefängnisses.
Nicht einmal Joseph, Lidias Anwalt, gelingt es, sie daraus zu befreien. „Weil du dir nichts mehr wünschst, als frei zu sein, hast du so viele Regeln aufgestellt, dass diese Regeln dich unfrei gemacht haben. Dein Kampf gegen Helmut hat sich damit gegen dich gewendet, weil du nur das Negative um dich wahrnimmst und nur das Negative für die Wahrheit hältst (…) Du fährst völlig automatisiert und widerwillig weiter auf den Schienen der Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit (…)“. (S.128) Seiner Liebe zu ihr und seinem Ansinnen, sie zu heiraten, kann sie nicht nachgeben.
Ana Bilic schöpft in ihren Motiven aus der eigenen Biographie, ihrer Tätigkeit als Juristin, Übersetzerin, ihrer Liebe zur Natur und zu dramatischen Texten, ihren – wie sie selbst sagt – zahlreichen Wegweisern, die sie tunlichst nicht geprägt haben mögen. Und dennoch: die aus der literarischen Doppelsprachigkeit hervorgehende wohltuende Ambivalenz der in Zagreb geborenen Autorin spiegelt sich in den Figurenkonstellationen ihrer Werke. „Anatomie einer Absicht“ auf die Ebene der häuslichen Gewalt einzuschränken, würde dem Text weitaus nicht gerecht werden. In fünf sehr unterschiedlich gewichteten Kapiteln stellt Bilic das Schreiben über Gewalt in Beziehungen selbst zur Diskussion, indem sie dem Moment der Betroffenheit nicht nachgeht und ein stilisiertes Idealbild einer Ehe über alle Leiden stellt, diese Haltung aber durch Überzeichnung immer wieder unterläuft. Die „Gesellschaft“, das Umfeld der Figuren, lässt dies zu, mehr noch, sie erhält – dem Chor in der griechischen Tragödie gleich – einen Auftritt auf der Bühne des Lebens, um am Ende doch Zuschauer zu sein, bei der Anatomie einer Absicht.