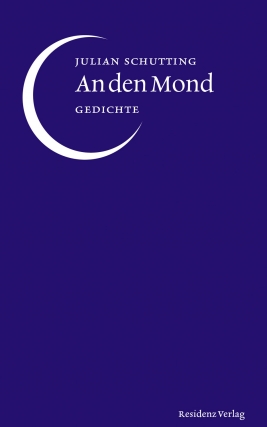Julian Schutting versammelt in dem schmalen Band An den Mond „Naturgedichte“, Gedichte „zur Kunst“, „Politisches“ und Gedichte „über Gedichte und an Dichter“. Der 1937 in Amstetten geborene Schriftsteller versteht seine Lyrik nicht als „creatio ex nihilio“, sondern als schöpferische Anverwandlung der literarischen Vergangenheit, der Figuren Shakespeares und Schillers, der Verse Goethes und Hölderlins. Schutting setzt seine Gedichte in Beziehung zu den klassischen Werken der Literatur, er schreibt sie weiter, integriert sie in neue Kontexte, gestaltet sie um und verändert so den Blick auf sie. Sein Schreiben ist ein zur Tätigkeit gewordenes, ein schöpferisches Lesen, es sucht und findet Leerstellen in den überlieferten Texten, es ist, wenn man so will, ein Dialog mit bereits Geschriebenem, ein Dialog mit Toten.
So tritt der Dichter wie Unzählige vor ihm an „Ophelias Wasserbett“ und hebt an zu einem weiteren Gesang auf die „vielbesungene“ Gestalt aus Shakespeares Hamlet. Durch die Betonung ihrer Schönheit und sanften Weiblichkeit und unter Vernachlässigung der Doppeldeutigkeit ihrer „mad songs“ wurde Ophelia besonders im 19. Jahrhundert als schmückendes Beiwerk der Shakespeareschen Tragödie gelesen, alles Irritierende und Erschreckende an ihrer Rollenfigur wurde zugunsten einer Ästhetisierung ihres Wahnsinns ignoriert. Auch Schuttings drei Gedichte an Ophelia stehen – scheinbar – in der Tradition der Ästhetisierung des Ophelia-Motivs in der lyrischen Dichtung der Jahrhundertwende. Schutting zitiert diese Lesart, um sie jedoch postwendend in Frage zu stellen, indem er Ophelia selbst das Wort erteilt, die scharfzüngig gegen ihre traditionelle Opferrolle aufbegehrt und sich spöttisch herablassend an das faule „Poetenpack“, Nutznießer ihres „Bildungsstrandgut speichernden Eigennamens“ wendet:
„damit euch auf faulig Wesendes angewiesene Krüppel / mein Zugrundegerichtetwerden zur Rettung / der Dichtkunst gelänge, hättet ihr jedoch / mit trockenen Worten mein Bachbett zu entsumpfen, / in euren wuchernden Zeilen Entbehrliches / wie Schlingkraut auszureißen, anstatt euch / bilderlos Blinde auf Trügendes zu verlassen / wie auf das seichte Wort >Untiefen<, das Tiefe / vortäuscht.“
Im Nachdenken über den Zusammenhang von Kunst und Tod, über die Macht des Wortes und über das Wesen der Dichtung schafft Schutting seinerseits Wortkunstwerke, die ihre Beschaffenheit und ihr Entstehen lustvoll nachvollziehen und ironisch hinterfragen. Trotz ihres freien Rhythmus und ihrer offenen Form wirken seine Gedichte eigentümlich anachronistisch, sie atmen das Bildungsgut der Antike, den Geist der Aufklärung, die morbide Sinnlichkeit der Romantik, sie tönen wie das Echo aus einer vergangenen Zeit. Doch dieses bleibt nicht unbeantwortet, Schutting entgegnet ihm mit der Stimme des zeitgenössischen Dichters. Er ist sich dessen bewusst, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, schwärmerisch naiv, ohne ironische Brechung, von der Hingabe an die Schönheit der Natur oder von glücklicher Liebe zu singen.
Das Ideal des Wahren, Guten und Schönen kann nur noch in der Verneinung beschworen werden: „Das Wahre ist häßlich“ und „Häßlich [ist auch] das Schöne, nicht schön!“. So manche „Strophe geistesschwach missgestalt / Wird keineswegs von klassischer Luft durchweht“ und „über unerwünschte Nebenwirkungen / pathetischer Wald-Elegien informiert Holzwurm, notfalls Jagdaufseher.“ Hinter dem hier angeschlagenen humoristischen Ton verbirgt sich jedoch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, ob es – nach Auschwitz – nicht barbarisch sei, Gedichte zu schreiben. Wenn selbst die überschwängliche Beschreibung eines nächtlichen Gewitters jede Unschuld eingebüßt hat, „insofern, als auch so sein dürfte / konventioneller Krieg: / nächtliche Bombenangriffe, / rundum stürzen Häuser ein, / aber das alles zu Amselbegleitung!“, gilt es dann nicht endgültig zu schweigen?
Schutting will nicht schweigen, sondern Unsagbares zur Sprache bringen. Dem Vorwurf der Barbarei begegnet er, indem er ihn nicht entkräftet, sondern ihn stets implizit und explizit in seiner Dichtung reflektiert. Diese ist deshalb jedoch keineswegs nur düster und trostlos; Schutting neigt nicht zu moralisierenden Gesten. Sein Werkzeug ist die dichterische Sprache, ihr fühlt er sich verpflichtet, nur mit ihr vermag er der Wirklichkeit und der Kunst beizukommen, mal ernsthaft, mal ironisch.