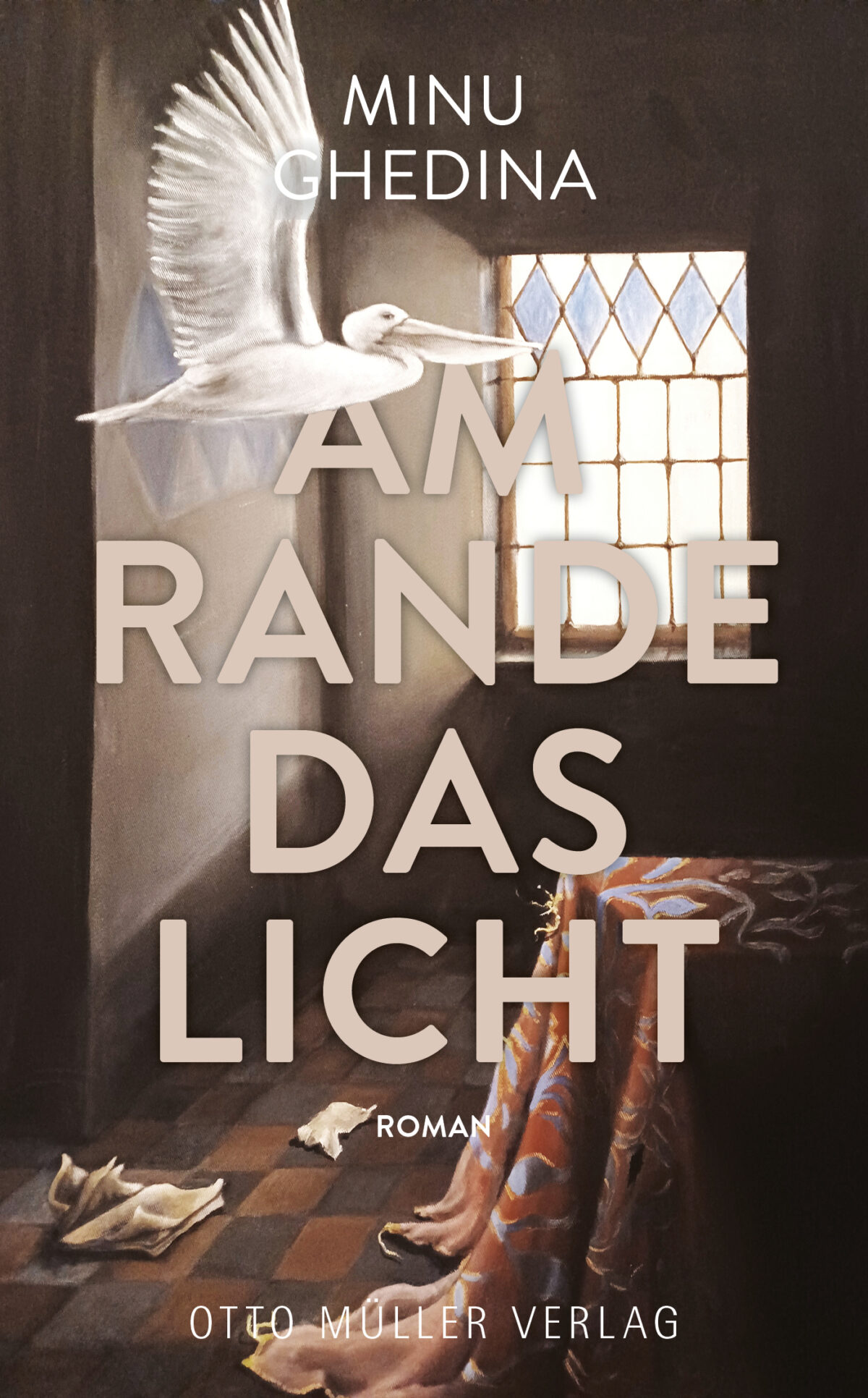Minu Ghedina versteht es, ihre Mehrfachbegabung und damit einhergehende Erfahrungen produktiv zu verwandeln. In ihrem 2022 veröffentlichten Roman Die Korrektur des Horizonts (Otto Müller Verlag) standen die Kostümbildnerin Ada und mit ihr die Film- und Theaterwelt im Zentrum des Geschehens. In ihrem aktuellen Roman hingegen dreht sich alles um die bildende Kunst, vor allem um die Bildhauerei.
Sie wählte diesmal eine männliche Hauptfigur, die auf Suche nach Sinn und einem Platz im Leben ist. David ist ähnlich introvertiert wie Ada und voller Zweifel und Ängste. Anders als sie wächst er als Einzelkind in einem behütenden Elternhaus auf, in dem Bücher und Kunst eine wichtige Rolle spielen. Sein Vater ist Leiter eines Museums, seine Mutter Bibliothekarin. Beide sind ihrem Sohn liebevoll zugewandt, geduldig und tolerant. Auch der Großvater lebt im selben Haushalt, ein Ökonom, der die Natur und seinen Enkelsohn liebt. Er nimmt ihn zu seinen Exkursionen in die Wälder mit, wo er ihm den achtsamen Umgang mit der Natur vorlebt und ihn lehrt, Baumarten am Geruch ihres Holzes zu erkennen.
Schon im Volksschulalter entscheidet der Junge, dass er Künstler werden will. Erste Irritationen gibt es, als seine Angst vor dem Scheitern sichtbar wird. So widersetzt er sich der Lehrerin und weigert sich, eine Bleistiftzeichnung auszumalen. Ein Wald besitze unendlich viele Grüntöne, rechtfertigt er sich: „Wie hätte ich die malen können.“ (S. 19)
David ist benannt nach der berühmten Statue des Renaissancekünstlers Michelangelo, einer Darstellung des biblischen Hirtenjungen knapp vor dessen Kampf gegen den Riesen Goliath. Als er mit seinem Vater nach Florenz fährt und erstmals vor der monumentalen Skulptur steht, ist er eingeschüchtert und verzagt, weil er erkennt, wie wenig stark er selbst ist. Auch sieht er die Meisterschaft Michelangelos und glaubt, dass er niemals zu solch großer Kunst fähig sein wird.
Trotzdem hält er an seinem Berufsziel fest. Bernhard, ein Freund seines Vaters, führt ihn in die Bildhauerei ein, doch als David sein erstes Werk in Angriff nehmen soll, gelingt ihm dies nicht. Wider Erwarten schafft er die Aufnahmeprüfung an einer Kunsthochschule, er scheitert jedoch erneut, diesmal schon bei der Anreise zu Studienbeginn. David scheut Entscheidungen, ergreift verschiedene Jobs, überwirft sich mit einer Klimaaktivistengruppe, beginnt ein Jusstudium. Eines Tages entdeckt er in einem Versteck mehrere Briefe seines mittlerweile verstorbenen Großvaters, die an dessen tote Schwester Hannah gerichtet sind. Sie starb als kleines Kind bei einem Unfall, an dem der Bruder sich sein Leben lang schuldig fühlte. Diese Briefe enthüllen Geheimnisse des Großvaters, die schließlich dem Leben Davids eine Wende geben.
Am Rande das Licht ist ein Roman von knapp vierhundert Seiten. Er ist in drei Abschnitte gegliedert, die mit „Suchen oder finden“, „Auf halbem Weg“ und „Bleiben oder gehen“ betitelt sind und annähernd chronologisch von Davids Suchen, von seinem Zweifeln und Scheitern berichten.
Zahlreiche Motive durchziehen den Band, die mit visuellen Eindrücken in Zusammenhang stehen, zum Beispiel das Licht, Lichtveränderungen und das Spiel der Farben in der Natur, in Räumen und auf Kunstwerken, oder mit olfaktorischen Wahrnehmungen, verschiedenen Gerüchen und Düften. Zu einem Motiv werden auch eingestreute Fragen, die, ein gestalterisches Prinzip, mit einem Punkt und nicht mit einem Fragezeichen enden. So heißt es gleich zu Beginn: „Wie fing es an. Warum fing es an. Oder auch: Wo fing es an.“, und wenige Zeilen später: „Wann fing es an.“ (S. 11)
Ein schon auf den ersten Seiten häufig verwendetes Wort ist Erinnern, sind Erinnerungsbilder und Erinnerungsfelder. Ein wenig zu oft gibt es Zwischenräume und Fugen, in die etwas fällt, wo sich etwas verheddert oder die etwas freigeben. Auch der erste Satz des Buchs „Letztendlich bleiben wir, was wir sind.“ (S. 11) erscheint in den drei Kapiteln mehrfach wie ein Refrain.
Auffallend ist die wenig differenzierte Figurenzeichnung und die fehlende Entwicklung der Hauptperson. So gibt die Autorin mehrmals Hinweise auf Davids Alter. Doch der neunjährige Grundschüler spricht, denkt und agiert nicht wesentlich anders als der 25-jährige Jusstudent. Auch das übrige Personal redet auf recht ähnliche Weise. Das vermittelnde Medium von Literatur aber ist Sprache. Und was Minu Ghedina in diesem Roman fehlt, ist eine literarische Sprache, mit der sie ihre Figuren präzise zeichnet. Vielleicht hätte ein beherzterer Eingriff des Lektorats manches zu korrigieren vermocht, nicht nur, was die Korrektur kleinerer Fehler und sachlicher Unrichtigkeiten sowie das Streichen ausufernder Wortwiederholungen betrifft.
Der Roman weist deutliche Längen auf und unterfordert das Lesepublikum, dem wenig Raum für die eigene Imagination bleibt, weil das immer Gleiche mit den immer gleichen Worten endlos ausgebreitet und wiederholt wird. Die Dialoge sind meist erstaunlich trivial und inhaltlich dürftig. Über weite Strecken wird zudem nicht erzählt, sondern bloß behauptet. Statt einer emotionalen und atmosphärischen Unterfütterung gibt es eine Flut an schlichten Eigenschaftswörtern. Zu vieles ist zart, sanft, scheu und schön, auch neu, groß, gut und kurz, oft mit Beifügungen wie sehr, beinahe oder leicht, während auf dem anderen Ende der Gefühlsskala dunkel und dumpf für so manches herhalten müssen. Die Autorin liebt die Worte warm und Wärme, die beide Platzhalter für nicht näher beschriebene angenehme Gefühle sind, ungeachtet dessen, dass die Sonne, ein Körper oder Körperteil für Ghedina offenbar dieselbe Art Wärme haben wie ein Stein oder Beton, die von sich aus nie warm sind.
Gern wird zu platten Kommentierungen gegriffen, gern auch zu verkitschten Stimmungsbildern, wenn etwa der Himmel „durch kleine Risse im Blätterdach tropfte“ (S. 18), ein Blick „stumm im dumpfen Waldlicht“ (S. 20) hängt oder es heißt „die Mondfalten brannten durch das Fenster“ (S. 187). Zudem stolpert man über zahlreiche Stilblüten wie „Gebeutelt vom Tagesgeschehen und der eigenen Fremdheit, rieb sich sein Inneres an der Ungastlichkeit des Unmöglichen.“ (S. 259). Oder: „Diese geschenkte Zeit tat gut. Sie hängte sich unter die Wimpern, wenn das Abendlicht seitlich einfiel“. (S. 216) Oder wenn es in einem (falschen) mathematischen Vergleich heißt: „der längste gemeinsame Nenner war unausweichlich und beinahe unerschöpflich“. (S. 163) Und es gibt verwackelte Zuschreibungen und Subjektsetzungen, die einem Stilprinzip entsprechen könnten, aber bloß da und dort unvermittelt auftauchen. So heißt es etwa „Die Erinnerung ist sorgsam um ihn bemüht“. (S. 12), „Die ungelesenen Briefe waren in ihrer Geheimniskrämerei wie Zauberer.“ (S. 254), „Faustgroß thronten die Nachtgesänge in den Waldspalten“ (S. 158) oder „Die aufgemalten Krähen lehnten ihre kräftigen Körper kommentarlos an die Wände.“ (S. 155) – dass hier Alliterationen gesetzt werden, macht den Satz nicht weniger komisch. Diese Liste ließe sich lange fortsetzen.
Im Buch heißt es einmal über Davids Lehrerin, dass sie „mit ihrem Wortschwall die Wände beklebte.“ (S. 35) Minu Ghedinas Am Rande das Licht gleicht einem solchen Wortschwall, der jedoch nicht an Wänden klebt, sondern uns als Literaturbemühung entgegenflutet und einen Roman simuliert. Vielleicht hätte sich die Autorin für dessen Erarbeitung mehr Zeit und kritische Distanz zum Geschriebenen zugestehen müssen, um einen stimmigeren, sprachlich überzeugenderen Roman vorlegen zu können. Denn wie es im Buch heißt: „Alles braucht seine Zeit, alles braucht seinen Raum, um wirken zu können.“ (S. 83)
Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com