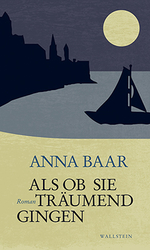Die 1973 in Zagreb geborene Autorin ist in Klagenfurt und Wien aufgewachsen und lebt heute abwechselnd in beiden Städten sowie auf der Insel Brac, und sie ist schon in ihrem Aufsehen erregenden Debüt „Die Farbe des Granatapfels“ erzählerisch nach Dalmatien zurückgekehrt. Zurückgekehrt deshalb, weil ihr erster, 2015 publizierter Roman stark autobiografisch war, inspiriert von vielen Kindheitssommern, die sie, deren Mutter Kroatin ist, in diesem Teil des einstigen Jugoslawien verbrachte.
Ihr neuer Roman spielt neuerlich in Dalmatien. Sie erzählt von der Welt, in der ihre Hauptfigur Klee um das Jahr 1920 herum geboren wird. In dem einfachen, armen Dorf, das hoch und weiß über der Meeresküste am Hang hängt, ist das Schicksal eines jeden vorgezeichnet: Der Sohn von Bauern wird Bauer. Es handelt sich um eine ländliche Welt, in die die Moderne bisher nur sporadisch eingedrungen ist. Gerade einmal fünf Radiogeräte gibt es, und nur einen Arzt, der der einzige Jude weit und breit ist und als einziger eine größere Bibliothek hat. Hier wächst Klee, der Bauernsohn, mit seinem jüngeren Bruder Malik auf – und natürlich sind die Namen kein Zufall, hier entlehnt dem Schweizer Maler, der viele Engel malte, auch einen „Engel der Geschichte“, dort entnommen einem Prosatext Else Lasker-Schülers, in dem sie ein Gegenreich imaginierte.
Zwei ältere Brüder Klees wie auch ein halbes Dutzend weiterer junger Männer wanderten aus, nach Amerika, nach Australien, wollten Armut, Not und der Dürre, die die Region regelmäßig heimsucht, entrinnen. Das führt vor allem bei den Müttern zu einer emotionalen Verhärtung und Verknöcherung. Um die Trennung zu verkraften, erziehen sie die jüngeren, noch im Haushalt lebenden Kinder mit um so kräftigerer, weder Erbarmen noch Zärtlichkeit kennender Hand.
Es ist den Heranwachsenden aber dennoch ein Idyll, inmitten von Äckern, Feldern, Tieren aufzuwachsen. Und da gibt es Lily, die Tochter des Arztes, die seit einer Mutprobe, einem Sprung vom Kliff ins Meer, hinkt, das damals gebrochene Bein ist nicht gut wieder zusammengewachsen. Lily wird Klees Schwarm. Und doch hält er Abstand. Denn sie ist nicht nur schöner als die anderen, sie ist auch klüger und mutiger. Seine Anbandelungstaktiken fruchten allesamt nicht, ja, werden falsch aufgefasst.
Dann wird Klee zum Militärdienst eingezogen, es ist der Sommer 1940. Niemand erwartet, dass sein Land, ein Königreich, überfallen würde. Und doch geschieht es. Klee muss kämpfen, seine Einheit wird fast aufgerieben, er, schwer verletzt und für tot gehalten, auf einen Lastwagen mit Leichen geladen, rutscht während der Fahrt ab, wird von Bauern gefunden, erneut für tot gehalten, doch dann rührt er sich, kommt in ein Lazarett und schlägt sich von dort mühsam zurück nach Hause durch. Wo ihn niemand mehr erwartet. Denn die Nachricht der Niederlage hat auch das Dorf erreicht. Das Land ist inzwischen besetzt von den siegreichen Soldaten aus dem Norden mit Stahlhelmen auf den Köpfen. Als Klee einigermaßen zu Kräften gekommen ist, bildet er eine lokale Widerstandsgruppe, überfällt die Soldaten, die das Dorf und die Umgebung aussaugen und schikanieren. Bei einer solchen Attacke wird Malik tödlich verletzt.
Dann kehrt der Terror ein, die Waffen-SS übernimmt das Sagen, es gibt immer brutalere Strafaktionen, Exekutionen an harmlosen und geistesschwachen Dorfmitgliedern werden öffentlich vollzogen. Die Résistance ist keineswegs unumstritten. Teile des Dorfes werden in einem Feuer zerstört, auch Lilys Elternhaus. Dann endet der Krieg. Und Klee, der Kommandeur seiner kleinen Partisanenschar, ist ein Held. Er wird geehrt durch ein Denkmal, das im Ort errichtet wird.
Doch er selber findet nicht mehr zurück ins Leben. Zu viel ist ihm widerfahren. Er fährt einige Jahre zur See, vor allem im Mittelmeerraum. Doch auch dies kann nicht ersetzen, was er verloren hat – Lily und die unerfüllte, niemals gelebte Liebe zu ihr. Auch wenn Klee Ida, in die er sich während des Krieges verliebte, mittlerweile geheiratet hat, erst ein Kind zur Welt kommt, später ein zweites tot geboren wird, so lebt er doch seelisch wie emotional außerhalb der Gegenwart. Dass Ida ihn erfolgreich drängt, ins Dorf zurückzukehren und dort eine Arbeit anzunehmen, verschärft diesen Zustand noch. Denn nun tritt sukzessive eine immer größer werdende, passiv-aggressive Distanz zu Tage, die noch immer anhält, während Klee nun im Spital liegt und physisch langsam der Welt entgleitet. Träumend geht er in der Lebenszeit zurück, träumt von Kindheit und Jugend, imaginiert den die Tiere so sehr liebenden Malik und Lily, immer wieder Lily, die die Deutschen erschossen, weil sie Jüdin war – ihr Vater war zuvor bereits auf dem Dorfplatz über den Haufen geschossen worden –, ausdauernd, sehnsüchtig und das verlorene Glück betrauernd.
Anna Baar scheut nicht das Pathos. Ganz im Gegenteil. Ihre Sprache ist reich mit Atavismen, Anachronismen und rhythmischen Bizarrerien durchwirkt. Es finden sich Passagen, die fast raunend daherkommen und auf originelle wie für die literarische Gegenwart bemerkenswert eigenwillige Weise einen sprachtänzerischen Sog entwickeln.
Mozarts Ave Verum (KV 618) ist, als Motto vorangestellt, der Subtext des Romans. Dieses vormalige stille Privatgebet, dessen Text auf Lateinisch auf der letzten Buchseite ebenso abgedruckt ist wie eine Notiz Paul Klees, in der er seine Verbundenheit mit Toten und Ungeborenen und diesseitig nicht Fassbarem in Worte kleidet, wird seit etwa 1500 laut zur Elevation gesungen, zum Erheben und Zeigen der gewandelten Gaben während eines eucharistischen Gottesdienstes: Feier der Verwandlung und Umwandlung und Beschwörung.
Es gibt immer wieder christologische Verweise – und so passt dieser Roman gut in das literarische Programm des Wallstein Verlags, der seit Längerem mit Patrick Roth einen Autor betreut, der vor zwanzig Jahren den ersten Band einer „Christus-Trilogie“ herausbrachte. Der stilistisch hohe Duktus erinnert an einen österreichischen Schriftsteller, an den Vorarlberger Robert Schneider, und an seine sprachlich gewagte „Luftgängerin“ wie an seinen Wiedertäufer-Roman „Kristus“. Es dürfte Jungphilologen einiges Vergnügen bereiten, sich mit den von Baar fein in den Text gewebten Motiven, Anspielungen und Referenzen aus Musik und Kunst, Kristologie und Bibel auseinanderzusetzen und sie zu entschlüsseln.