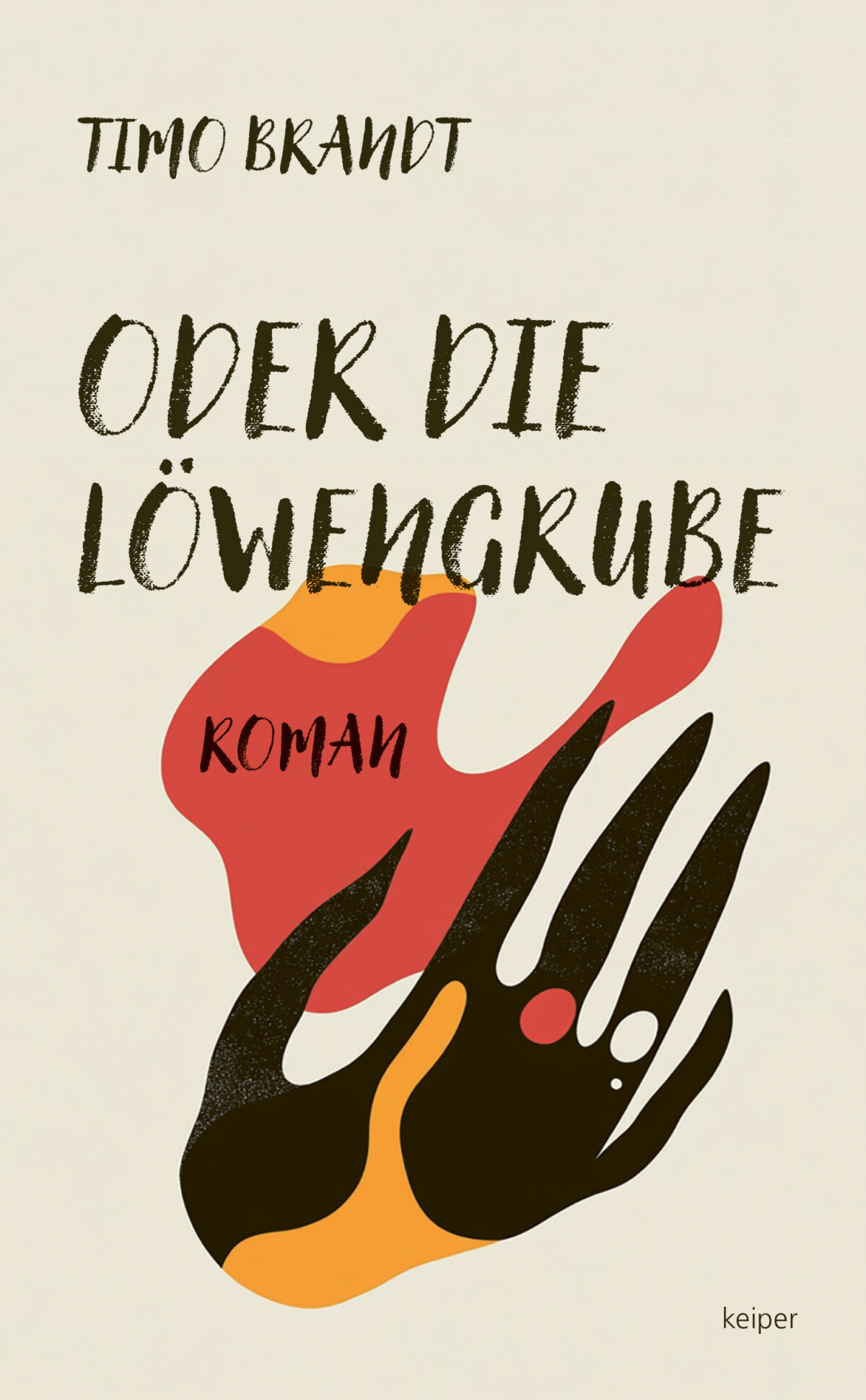Lynn und Daniel sind seit einigen Jahren ein Paar. Was sie zusammengeführt hat und sie auch stark verbindet, ist vor allem ihre gemeinsame Profession: Daniel ist Lyriker, Lynn schreibt Romane. Lynn – die Erzählerin im Text – hatte vor Daniel einige verunglückte Beziehungsversuche, die in ihr den Groll auf Männer haben wachsen lassen. Mit ihm teilte sie von Anfang an viele Wesenszüge und ihre Kommunikation war stets eine auf Augenhöhe.
Doch Daniel ist seit einiger Zeit krank. Seine seit der Kindheit fragile Gesundheit und die Anfälligkeit für Infekte waren nur die Vorstufe, ehe es anfing, ihm richtig schlecht zu gehen. Und das ohne erkennbare, geschweige denn diagnostizierbare Krankheit oder Aussicht auf Besserung. Ihr gemeinsamer Alltag ist nun strukturiert durch gute und unweigerlich darauffolgende schlechte Tage. Ab da fängt auch der Groll wieder an, in Lynn zu brodeln. Immer öfter ist sie wütend. Etwa auf Daniel, wenn er an schlechten Tagen zu Fatalismus neigt, aber auch auf die guten Tage, die einen Aufschwung vorgaukeln, der unweigerlich von den nachfolgenden schlechten wieder zunichtegemacht wird. Manchmal ist sie auch auf die ganzen Ärzt:innen wütend, die Daniel nicht helfen können und ihre Erfolglosigkeit auf die Einbildung und Wehleidigkeit des Patienten schieben. Auf diese Wut folgt zuverlässig Scham: für jeden Gedanken, in dem sie Daniel eine Mitschuld an seiner Krankheit und seiner Situation unterstellt. Doch Lynn fehlt – anders als ihrem schreibenden Ich in ihren Texten – im echten Leben der Mut, die Dinge zu benennen, die nicht mehr stimmen zwischen ihnen.
Lynns Romandebüt vor über vier Jahren war ein großer Erfolg. Der Plot löste jedoch auch heftige Kontroversen aus und vor allem auf Social Media wurde sie mit Kommentaren jedweder Art bombardiert. Daniel hatte sie in der Zeit sehr unterstützt, sich um sie gekümmert und seine eigene Arbeit hinten angestellt. Immerhin konnten die beiden recht stressfrei von ihren Bucherlösen leben. Der zweite Roman verkaufte sich ebenfalls gut und wurde sogar verfilmt. Nun aktuell an ihrem dritten Buch arbeitend, erlebt sie zum ersten Mal eine Art Schreibblockade, nicht, dass sie nicht schreiben könnte, vielmehr findet sie nicht den richtigen Ton, verzettelt sich in unwichtigen Details und weiß nicht so recht, wohin die Handlung führen soll. Immer wieder schleicht sich die Frage in ihr Bewusstsein, ob sie sich nicht völlig verrannt hat: Was will sie mit diesem dystopischen Text über eine postapokalyptische, matriarchal organisierte Gesellschaft – einfach nur etwas ganz anderes als bisher? So wie das neue Manuskript ihren Glauben an ihre Qualitäten als Autorin bröckeln lässt, hat auch die Beziehung Risse bekommen. Doch reichen wie bei einem leicht maroden Gebäude ein paar Sanierungsarbeiten aus? Ja, darüber sollten sie reden und „Bis dahin: möglichst wenig erschüttern, auf Zehenspitzen gehen“ (S. 119).
Und da ist noch Ben, einer von Daniels ältesten Freunden, den viele eher unsensibel bis sogar chauvinistisch finden (seine Frauengeschichten sprechen Bände). Lynn aber mag seine gelassene Art und teilt mit ihm die tiefe Abneigung gegen Geltungssucht bei anderen. Genau das erlaubt den beiden, über vieles einfach sprechen zu können, ohne dabei Rassismus, Sexismus, das Patriarchat oder andere gesellschaftliche Übel ständig mitdenken und thematisieren zu müssen.
Doch unter dieser inspirierenden und fruchtbaren Gesprächsbasis scheint noch mehr zu liegen: „Wie lange kann man ignorieren, dass jemand, den man mag, mit einem ins Bett gehen will.“ (S. 27) Lynn selbst hat schon vor längerem beschlossen, dass Sex für sie kein Ziel, sondern eine Frage von sich ergebenden Gelegenheit ist. Umso mehr schätzt sie die Vorteile einer festen Beziehung, ohne das immerwährende Spiel von Kennenlernen, Flirten und am Ende Sex zu haben. Sex ist für sie eines jener komplizierten Themen, über die es einfacher ist, einen Roman zu schreiben. „Nun ja, nicht leichter, aber befriedigender.“ (S. 29)
Timo Brandt stellt immer wieder geschickt eine Analogie zwischen Lynns Schreiben, ihren Romanen und den einzelnen Phasen ihrer Beziehung mit Daniel her. Es beginnt mit dem großen Debüterfolg, relativ am Beginn ihrer Beziehung. Der Traum vom Erfolg stellt sich ein, Lynn kann endlich auf Nebenjobs verzichten und sich auf das Schreiben konzentrieren. Es folgt der zweite Roman, der an den Erfolg des ersten anschließen kann und der die Qualität und Kontinuität ihrer schriftstellerischen Arbeit untermauert. Jetzt arbeitet sie am Manuskript zum dritten Buch und Lynn scheint darin – wie in der Beziehung mit Daniel – um das Eigentliche herumzumäandern, sich an den Symptomen aufzureiben und sich Nicht-Funktionierendes „schönzuschreiben“. Sie will nur zu gerne an dem festhalten, was so schon mal funktioniert hat, es nun aber offensichtlich nicht mehr tut. Und eigentlich will sie nur weg, weg von dem gescheiterten Manuskript und weg aus der Beziehung.
So präzise und punktgenau viele Formulierungen im Text sind, so auffallend poetisch sind manche Sprachbilder, die der Autor mit wenigen Worten eindrücklich erschafft. Dabei kommen ihm wohl seine Fähigkeiten als Lyriker zugute. Dann schreibt er Sätze wie: „Die Erinnerung an ihren fassungslosen Blick gereichte heute noch, ein kleines Schamfeuer in Lynns Kopf zu entfachen, gegen das sie mit zwecklosen Entschuldigungen für sich selbst anpustete, die das Feuer nur anfachten“ (S. 114f.) oder „Aber wohin mit der postkoitalen Zärtlichkeit, diesem jetzt leeren Sinngestell, dieser zurückgelassenen Sandburg“ (S. 133).
Und immer wieder finden sich Textstellen, die das Schreiben und die Literatur selbst ins Zentrum der Betrachtung rücken. Etwa wenn Lynn sich an ihre Studienzeit und an ihre Literaturprofessorin erinnert oder die Diskussionen und Gespräche mit Ben, bei denen die beiden Autor:innen und deren Werke analysieren.
Was den Titel betrifft, so liegt es wahrscheinlich an meinem eigenen Vornamen und meiner katholischen Früherziehung, dass mir sofort die alttestamentarische Geschichte des königlichen Traumdeuters Daniel in den Sinn kam. Dieser war durch höfische Intrigen, die seinen Glauben an Gott als Verrat am König hinstellten, in Ungnade gefallen und sollte den Löwen in der Grube zum Fraß vorgeworfen werden. Doch der biblische Daniel überlebte, weil ihm ein Engel erschienen war und den Löwen das Maul zugehalten hatte. Und auch Daniel im Roman ist gefangen in seiner Grube aus Krankheit und Depression, auch er wartet auf den rettenden Engel. Lynn hingegen muss sich eher die Frage stellen, ob sie der Löwe sein will oder nicht.
Wenn der Literaturprofessorin Dreesen, die Lynn im Studium so nachhaltig beeindruckt hat, vor allem jene Bücher am Herzen liegen, die etwas über das Leben aussagen, seine Banalität aushebeln und „eine[r] Anwandlung von Wirklichkeit, die sonst nirgends zu bestaunen war, eine einmalig konsequente Erfahrung“ (S. 114) darstellen, dann hätte Timo Brandts Debüt in ihrer Vorlesung mit Sicherheit seinen Platz gefunden.
Und zwei kurze Sätze aus Oder die Löwengrube klingen sogar, als hätte sich der Autor damit selbst einen absolut passenden Abschlusskommentar verfasst: „Menschlich – so menschlich, dass es einfach keine Kunst sein konnte, sich kein bisschen danach anfühlte. War das nun eine hohe Kunst oder eine hohle?“ (S. 109). Und mein wirklich absolut letzter Satz in dieser Rezension (und kein Zitat) antwortet darauf: Diesmal ist es hohe Kunst!
Daniela Fürst ist Kultur- und Mediensoziologin und seit 2004 redaktionell sowie organisatorisch Teil des Projektes literadio, das Gegenwartsliteratur hörbar macht .