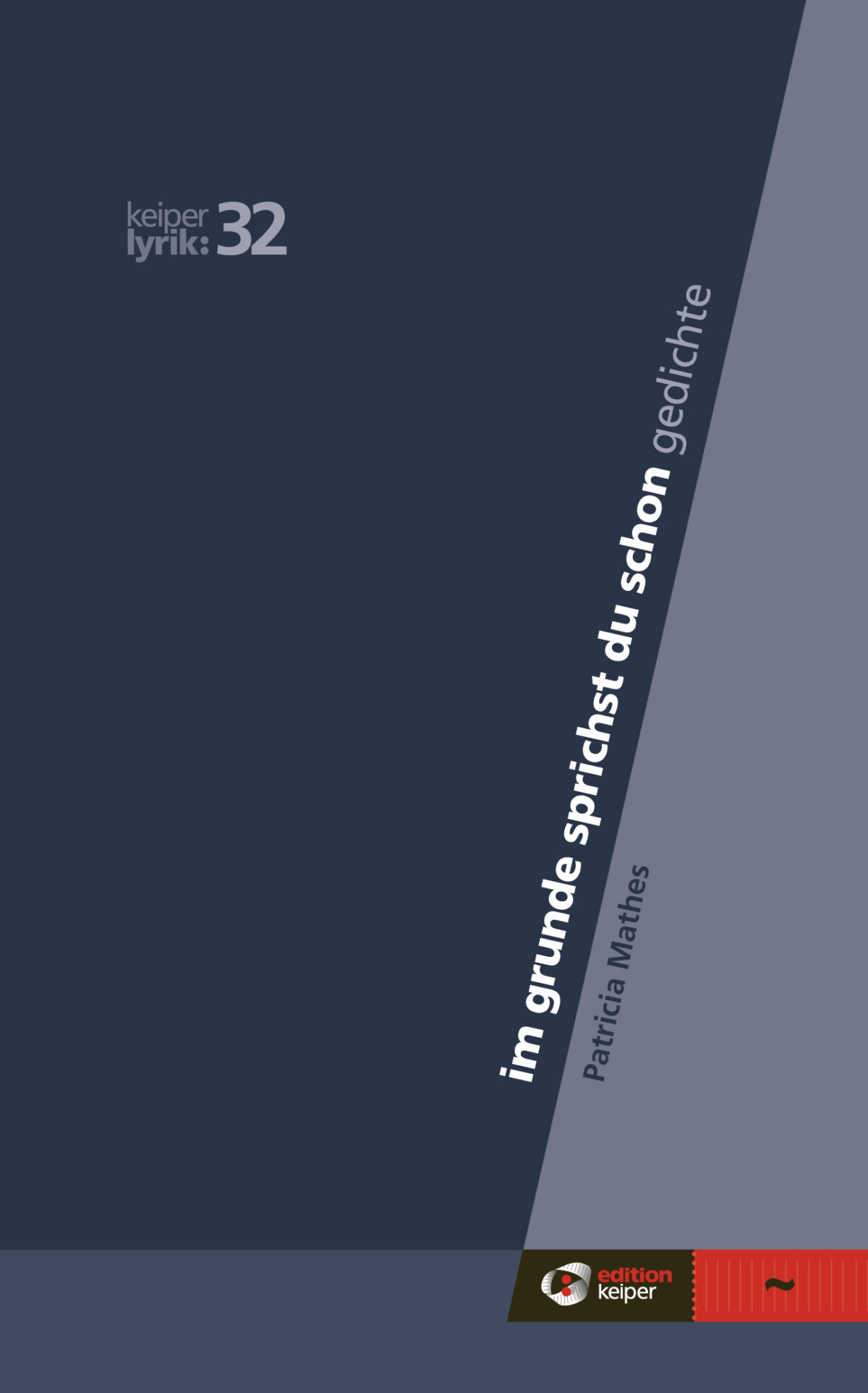Ein reflektierter akademisch geprägter Mensch um die dreißig: das Uni-Studium ist beendet, das des Daseins wird zunehmend als hinreichend interessantes Dauerprojekt begriffen, erste Lebens-, Liebes- und Berufserfahrungen inklusive, alle Sinne sind im Idealfall noch scharfgestellt auf die Suche nach der Essenz der Welt und noch nicht von den Alltagsroutinen abgestumpft, das Energiepotenzial ist in der Regel noch groß. Sind das nicht womöglich die besten Voraussetzungen für eine intensive und innovative Beschäftigung mit der poetischen Sprache?
Patricia Mathes, 1994 im niederösterreichischen Mödling geboren, steht nach Lehramtsstudien in Englisch und Französisch und mehrjährigen Aufenthalten in Frankreich und Wales noch relativ am Anfang ihres dichterischen Schaffens. Mit im grunde sprichst du schon hat die heute in Wien lebende und arbeitende Autorin in der renommierten keiper-lyrik-Reihe unter der Ägide des Herausgebers Helwig Brunner ihren erste selbständige Einzelpublikation vorgelegt.
Schon der erste Text im Buch sprich wort (S. 7) scheint beim Anlesen durch die Mittelachse und die strophische Gliederung einerseits sowie die jeweils nur auf ein zusammengesetztes Substantiv mit der dann doch stets getrennt geschriebenen Endung „wort” reduzierten Verse sowohl auf jahrhundertealte wie auch auf moderne Traditionen der Lyrik zu verweisen; in seiner eigentlichen Funktion handelt es sich dabei jedoch um ein augenzwinkernd vorangestelltes Inhaltsverzeichnis. Die mit sprich wort, stich wort, für wort etc. bezeichneten insgesamt dreizehn Kapitel beschäftigen sich alle mit konventionellen Redensarten und kodifizierten Alltagswendungen, die allerdings nicht immer leicht auszumachen sind: Patricia Mathes formt sie oft um, versteckt sie zwischen den Zeilen, transformiert nicht selten auch die ursprüngliche Bedeutung in ihrer poetischer Bearbeitung.
beidhändig schreiben/ ginge jetzt nicht und / einhändig / fährt die schrift so aus und / gibt sie dir // einen kleinen finger / nimmst du / ihr ganzes wort / wie eine // schotterstraße bergab und / zum beidhändig bremsen / reicht die zeile / nur halb (S. 15)
Hier deutet sich auch schon ein nicht unwesentliches Moment ihrer Diktion an: es ist eine pulsierende Energie, die pure Lust an der Sprache, die diese Verse vorantreibt. Die Vorwärtsbewegung wird durch keinerlei Interpunktion aufgehalten, auch die konsequente Kleinschreibung und häufige Enjambements befördern den Drive; doch die Autorin weiß sehr wohl um Strukturierung und ein gegebenenfalls notwendiges Ritardando, welches sie in den Worten selbst und ihren versteckten Bedeutungsvariationen sowie mittels geschickt gewählter Zeilenbrüche zum Ausdruck bringt. So entsteht durch die Dichotomie von Bewegung und Innehalten eine eigentümliche Spannung wie etwa im titelgebenden Gedicht:
im grunde sprichst du schon / denkst nur / in der gleichen stille das wort aus / dir aus / wie die stille / in dir / die sich im grunde doch stimme / mit der stille / die stimmlos darin vielleicht spräche / verzweigt (S. 23)
Im Kapitel stich wort geht das Formspiel zurück auf die uralte Tradition des Akrostichons: die Anfangsbuchstaben der Verse ergeben einen versteckten Zusammenhang. In diesem Fall sind es die ganz unverstellten Redensarten „würmer aus der nase ziehen“, „dunkel wie in einer kuh“ und „da liegt der hund begraben“, welche zu drei etwas längeren Texten führen, in denen sich die Mathessche Welt der surrealen Verschiebungen vielleicht besonders schön manifestieren: „zum beispiel / in genau diesen falschen film / einzuziehen sich darin eine / hütte zu bauen zum beispiel aus dem klang der / erfundenen namen zu leben bis einer vielleicht / nachwächst den es gab“ (auf das Wort „ziehen“, S. 30).
Häufig wiederkehrende Vokabeln wie Sprache, Schrift, Satz und Stimme verweisen auf eines der impliziten Hauptthemen von Patricia Mathes: ihre Verse sprechen immer wieder von der Kommunikation und ihrem Scheitern, „als gäbe es tatsächlich wo / ein erzählbares / wort“ (S. 47).
Das lyrische Ich, bei Mathes nicht selten auch ein Du oder ein Wir, sucht sein über künstlich-künstlerische Parallelwelten verstreutes Selbst, manchmal sogar durch die unwillkürliche Zurücknahme einer soeben aufgestellten Aussage, die in ihrer Doppeldeutigkeit schillert und gleichzeitig auch wieder das Gegenteil behauptet: „das sieht man noch nicht / man sieht / was du siehst / sieht man nicht / in dem raum / in dem das bild / entstanden ist“ (S. 50).
In vielen Gedichten gibt es eine Art Als-ob, das imaginierte Parallelwelten andeutet, in denen anderes möglich wird als in unserer scheinbaren Realität. Immer wieder begegnet uns fragiles Ich-Du-Wir-Stückwerk, verstreutes, wieder zu einer Einheit zu versammelndes Individualempfinden: „horch / die kleiderhaken atmen / eine ganze lunge / wartender / versionen deiner selbst / nur ohne dich / scheint sie / die form verloren zu haben“ (S.124).
Ständig ändern die aufeinander folgenden Verse und Strophen ihre semantische Bedeutung durch die Setzung neuer Bezüge und Wortwendungen, faszinieren durch ihre Rätselhaftigkeit:
deiner tür / und deinem raum // schließt sich ein deckel / völlig / aus / luft / löchern / beatmet / legt dein / ich sich / über dich // erkennt darunter / wer du bist / nicht immer an / der doch schon / eingeprägten schicht / des sich // auf dich / gelegten / fingers (S. 51-52)
Dabei ist Mathes mitunter nicht nur ganz grundsätzlich mit der Findung ihres lyrischen Subjekts befasst, sondern durchaus auch mit den Überlebensstrategien der Feinfühligen in einer Gesellschaft, in der plötzlich Dinge nicht mehr sagbar zu sein scheinen, ohne von „fauchtieren“ angegangen zu werden: „also stehen wir aus / angst uns zu bewegen / und bewegen uns / in uns // liegt die luft / mit fauchtierspuren bestreut / und wir / tun als ließe sich / wissen umleben“ (S. 49).
Das Subjekt des Gedichts ist oft lyriktypisch sehr nah an der Autorin und reflektiert die Unbehütetheit des poetischen Wortes auch in der Dichtenden selbst: „mit jedem mal dass / du hinsprichst / wird dein gedicht / immer obdachloser“ (S. 157). Es stellt die existenzielle Frage nach dem Leben und dem künstlerischen Schaffen schlechthin: „warst du / denn jemals / ein ort / an dem man / auf sich trifft“ (ebd.).
Diese Frage wird man beim Lesen der Gedichte für die Person der Lyrikerin Patricia Mathes allerdings uneingeschränkt bejahen wollen. Wer so nachdenklich und gleichzeitig voller Schwung und Elan zu formulieren versteht, hat seine poetische Sprache eindrucksvoll auf den Weg gebracht.
Marcus Neuert, geboren 1963 in Frankfurt am Main, Studium der Kulturwissenschaften an der FU Hagen, lebt und arbeitet nach langjährigen Stationen in Hessen und Baden-Württemberg als Autor, Musiker, Literaturkritiker und Kulturarbeiter in Minden/Westfalen und Coswig bei Dresden. Für seine Texte, die in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften sowie in mehreren Einzelpublikationen veröffentlicht wurden (zuletzt: Imaginauten. Ein Morbidarium in 21 Erzählungen. Free Pen Verlag, Bonn 2018 sowie fischmaeuler. schaumrelief. anagrammatische miniaturen. edition offenes feld, Dortmund 2021), erhielt er u. a. Auszeichnungen bei PostPoetry NRW (2014 und 2022), beim Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis (2017) und beim Lyrikpreis Meran (2021). Weitere Infos unter marcusneuert.jimdofree.com.