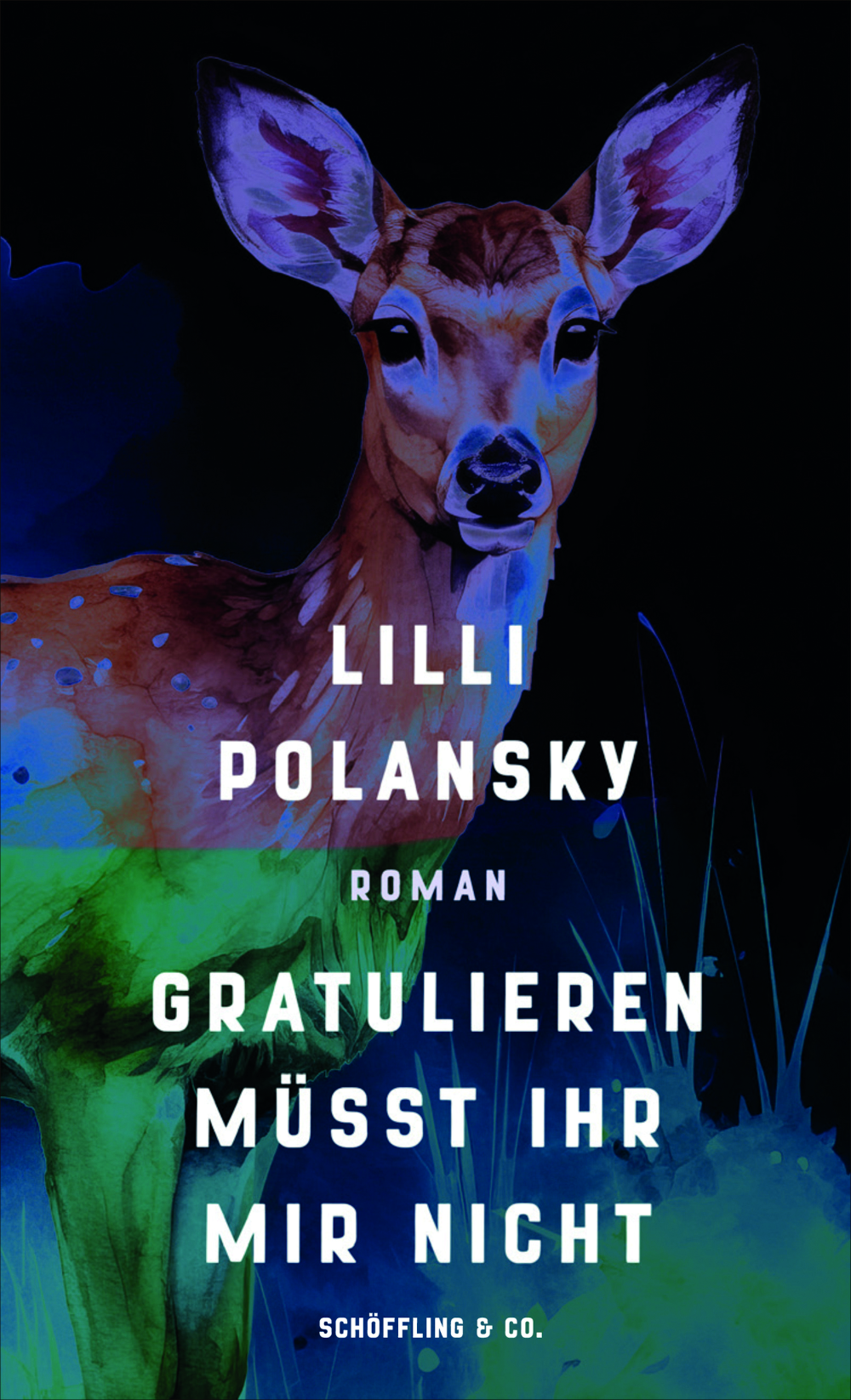„Und dann beginnst du zu zweifeln, ob es überhaupt jemals so etwas wie eine Sonne gegeben hat, du kannst dir nicht vorstellen, dass du jemals das Kitzeln der Sonnenstrahlen auf deiner Haut gespürt hast, dass du jemals an einem anderen Ort als diesem endlosen Labyrinth aus Traurigkeit existiert hast.“ (S. 232)
Bevor diese Sätze in Gratulieren müsst ihr mir nicht fallen, durchleben die Leser:innen gemeinsam mit Erzählerin Lilli P. eine Coming-of-Age-Geschichte, wie sie in der Form wohl noch nicht erzählt wurde. Der kämpferisch-trotzig anmutende Titel des Romandebüts der österreichischen Schriftstellerin Lilli Polansky lässt bereits erahnen, dass es keine Happy-go-lucky-Literatur ist, die die Leser:innen erwartet.
Die gerade einmal zwanzigjährige Protagonistin Lilli P. beginnt die Rekapitulation ihrer Geschichte mit dem schnörkellosen Satz: „Vier Monate nach meinem zwanzigsten Geburtstag bekam ich einen Herzschrittmacher eingesetzt.“ (S. 9) Eine junge Frau mit einem zu langsam schlagenden Herz – was an sich schon genug Stoff wäre für einen Roman, ist hier nur Startschuss für eine packende, sich über Jahre ziehende Leidens-, aber auch Selbstermächtigungs-Erzählung einer jungen Frau, deren Körper sich immer mehr gegen sie zu wenden scheint: „Ich fragte mich, ob dieser Körper wirklich mein Körper war, warum dieser Körper sich anfühlte, als wäre er mein Feind, warum gerade dieser Körper mein Körper war, warum ich einen Körper hatte, dem ich nicht vertrauen konnte, einen Körper, der gegen mich arbeitete.“ (S. 195f.)
In Rückblenden und entlang ihres Krankheitsverlaufs erzählt Lilli in mal sachlich-nüchternem, mal poetisch-sensiblen Ton von einem Leben zwischen Krankenhausaufenthalten, Depressionen und unterschiedlichsten Diagnosen, in dem ein Gehirntumor beinahe zu einem Nebensatz wird. Und Lilli kämpft: mit sich, mit ihrem ihr den Dienst versagenden Körper, gegen die Zuschreibungen von außen, die ihr oft mehr zusetzen als alles andere: „Ich wollte keine ganz Arme sein und auch kein rohes Ei. Ich wollte ignorieren, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmte.“ (S. 39) Und sie versteht, dass eine so ausufernde Krankengeschichte wie ihre andere verunsichert – daher lernt sie schnell, das tatsächliche Ausmaß ihres Leides gegenüber anderen zu verschleiern, zum Schutz der anderen.
Halt gibt Lilli dabei schon von Kindesbeinen an das Lesen: „Ich lese, wenn mir die Welt dunkel erscheint. Es macht sie für einige Stunden hell. Ich lese, wenn mir alles zu viel wird und ich einige Zeit nicht mehr das Mädchen mit der runden Brille sein will, sondern eine Superheldin, die die Welt rettet.“ (S. 81) Die Literatur ist ein Fluchtpunkt für das sensible Mädchen mit der runden, blauen Brille, die andere Kinder als „schirch“ bezeichnen; ihre In-sich-Gekehrtheit macht Lilli lang zu einer Außenseiterin. Doch als sie sich durch die Schulzeit gekämpft hat – mit Mathematik als Endgegner –, fehlt Lilli der letzte Mut, um zu studieren, wo ihr langsames Herz sie eigentlich hintragen würde. Statt sich der Germanistik zuzuwenden, entscheidet sie sich aus Vernunft für „etwas Gscheids“: „Germanistik zu studieren war ein heimlicher Wunsch, den ich mir selbst nicht erfüllen wollte. Tief in mir wusste ich, dass es eigentlich viel besser zu mir passte als Jus.“ (S. 30)
Doch dieses Jura-Studium passt nicht, es zwickt und schmerzt an allen Ecken und Enden, wie Lilli in Beobachtungen seelenloser Kommilitoninnen und erfolgsgetriebener Freunde feststellt. Und in Lillis Kopf beginnt es zu knarzen und zu quietschen – bis ihr Körper eines Nachts komplett den Dienst versagt, sie auf der Toilette zu Hause zusammenbricht und aufgrund einer schweren, lebensgefährlichen Blutung ins Krankenhaus eingeliefert wird und dort mehrere Tage um ihr Leben kämpft.
Immer an Lillis Seite: ihre Mutter. Und hier liegt eine der größten Stärken von Pollanskys Debüt: Die kompromisslose Loyalität und der moralische Kompass der Mutter sind nicht nur Konstanten in einem von Schicksalsschlägen gebeutelten Leben, sondern geben auch den Leser:innen Halt. Besonders in den Passagen, die in Lillis Kindheit spielen, als die Mutter noch alleinerziehend war, entwickelt der Text seine berührendsten Momente und wärmsten Passagen. „Ein müder Vogel und sein Küken in einem kleinen Vogelnest.“ (S. 16), so beschreibt Lilli diese innige, aber nicht immer einfache Mutter-Tochter-Beziehung, und so ist Gratulieren müsst ihr mir nicht auch das Porträt einer Mutter, die wie eine Löwin für ihre Tochter kämpft, wie Lilli später erkennt: „Ich hatte es nicht immer sehen wollen, aber sie hatte sich immer schon bei noch so kleinen, unbedeutend erscheinenden Dingen für mich eingesetzt, wenn ich nicht den Mut hatte, es für mich selbst zu tun.“ (S. 183)
Nicht mehr an Lillis Seite hingegen ist ihr erster Freund, die erste große Liebe, der sie kurz vor ihrer Herz-OP nach drei Jahren Beziehung verlässt. Immer schon fürchtete sich die junge Frau vor dem Tag, an dem er ihr und ihrer Krankengeschichte überdrüssig werden würde: „Du sagst, dass du mich liebst, und ich tue so, als würde ich dir glauben. Ich sage, dass ich dich auch liebe, und du tust so, als würden sich meine Worte für dich nicht wie eine Belastung anfühlen.“ (S. 156) Denn auch die größte Liebe läuft Gefahr, an äußeren Umständen zu zerbrechen, und Lilli, die bereits als Teenager an Depressionen leidet, weiß das. Als ihr Freund wirklich geht, fast spurlos aus ihrem Leben verschwindet, ist diese schmerzhafte Erfahrung wirkungsvoll mit dem Einsetzen des Herzschrittmachers gegenmontiert – eine Technik, die sich durch den gesamten Text zieht.
Überhaupt ist Pollanskys Buch schlau gebaut: Die nüchtern betitelten Kapitel halten die fast übergroßen Themen wie Liebeskummer, schwere Erkrankungen, Einsamkeit, das Fremdsein im eigenen Körper und das Leiden an Depressionen zusammen, und geschickt webt die Autorin viele persönliche Erlebnisse der Protagonistin mit ein, die oft zu kleinen Meisterstücken werden. Besonders einprägsam sind die Beschreibungen einiger ihrer Mit-Patient:innen, allen voran Viktoria. Die Frau ist lange ihre Bettnachbarin und redet eine unverständliche Sprache, ist unruhig und attackiert Lilli sogar mit einem Joghurtbecher. Und dennoch ist es genau diese verwirrte Frau, die ihr einen kleinen Lichtblick in der Verzweiflung schenkt: „Ich erschrak und wandte den Blick schnell wieder ab, doch aus dem Augenwinkel sah ich, wie Viktorias Mund sich zu einem breiten Lächeln kräuselte, wie sich ihre knochige Hand zitternd hob und wie sie mit dem Finger in meine Richtung zeigte. Meine ehemalige Zimmernachbarin, die mich zwei Tage zuvor noch mit einem Joghurtbecher hatte abschießen wollen, zeigte in meine Richtung, krächzte: »MEIN MAUS!« und schenkte mir ein breites Lächeln.“ (S. 215)
Es sind Momente wie diese, die Polanskys Prosa immer wieder leuchten lassen, die über all die traurigen und schrecklichen Augenblicke hinwegtragen und auf ein versöhnliches Ende hoffen lassen, auch wenn die Situation oft ausweglos erscheint. Und selten fühlt man sich einer Protagonistin verbundener als in den innigen Augenblicken, in denen Lilli inständig auf Genesung hofft: „Ich liege in ihren Armen und bete, dass das Loch in meinem Inneren nicht aufbricht, bete, dass dieser friedvolle Moment nicht durch meinen instabilen, kaputten Körper zerstört wird.“ (S. 175) Nichts als Frieden also wünscht sich Lilli, wünscht ihn ihrem mitgenommenen Körper, der ganz langsam wieder in Tritt kommt, und im Grunde ist es genau das, was man ihr auch als Leser:in wünscht: zur Ruhe kommen zur dürfen, ein friedvolles, freudvollen Leben führen zu können.
Und Schritt für Schritt nähert sich Lilli diesem Zustand. Der Weg ist auch am Ende des Romans noch nicht zu Ende beschritten, aber es zeichnen sich erste Veränderungen und auch erste versöhnliche Töne ab: „Ich starrte mich im Spiegel an, und ich vermisste meinen früheren Körper, obwohl ich wusste, dass er immer noch da war. Ich konnte ihn auf den ersten Blick nur nicht mehr erkennen.“ (S. 255) Was noch nicht oder nicht mehr zu sehen ist, ist trotzdem da.
Lilli Polanskys Debüt ist nicht gefallsüchtig und macht es den Leser:innen nicht leicht; es erspart sich selbst und uns nichts. Doch in diesem Schreibprozess findet eine junge Autorin sich selbst und zu eigener Stärke zurück. Gerade deshalb ist Gratulieren müsst ihr mir nicht ein so widerständiger und letztendlich ermutigender Text – und das ist wiederum ist etwas, zu dem doch gratuliert werden muss.
Stefanie Jaksch war einige Jahre als PR-Verantwortliche und Dramaturgin an deutschen Theatern tätig, seit 2011 lebt und liest sie in Wien, wo sie bis 2023 die Verlags- und Programmleitung für Kremayr & Scheriau innehatte. Die von ihr konzipierte Essay-Reihe übermorgen wurde u. a. mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch ausgezeichnet. Seit 2024 ist die Wortarbeiterin als freischaffende Moderatorin, Kuratorin und Lektorin unterwegs und hat das Büro für Kultur- und Literaturarbeit „In Worten“ gegründet. Im Herbst 2024 erschien bei Haymon ihr Essay Über das Helle – sich selbst versteht sie als (ver-)zweifelnde Anfängerin in immerwährender Transformation.