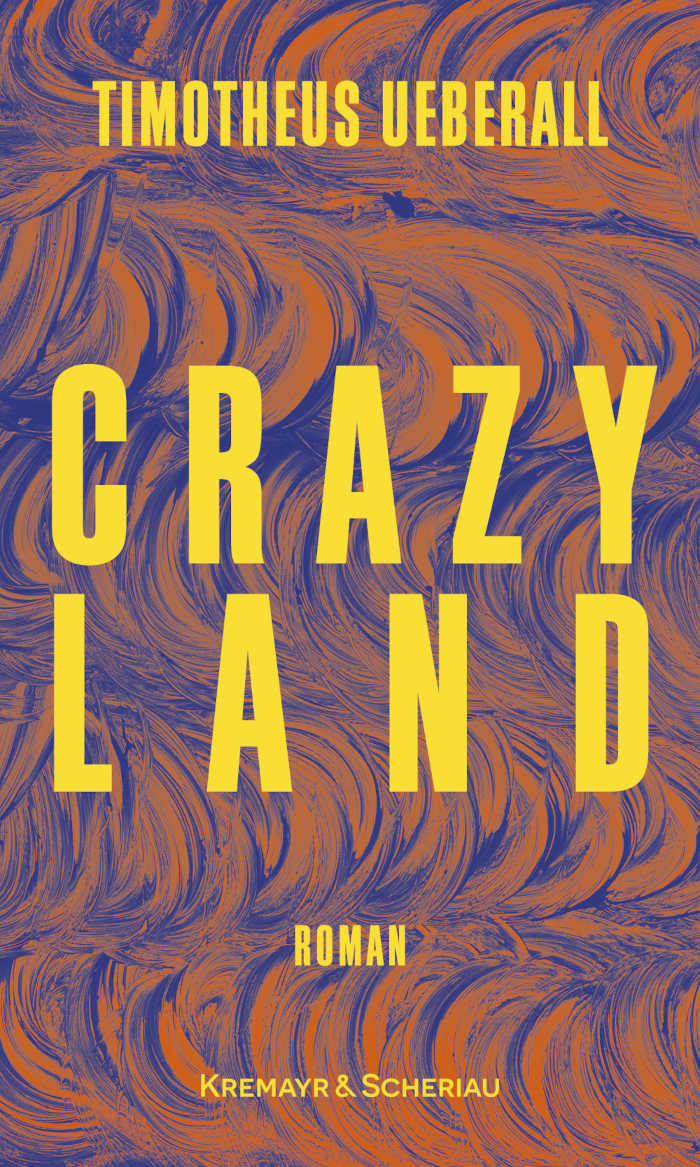Aki ist Student, theoretisch jedenfalls. Genau genommen ist die Inskription aber wohl nichts weiter als eine plausible Erklärung dafür, dass er keinem Beruf nachgeht – und auch sonst keiner geregelten Beschäftigung. Wozu auch? Es geht ja doch alles den Bach runter. Die Leute jagen algorithmengesteuert diversen Konsumgütern nach, deren Produktion in Summe die Welt ruiniert. Manche scheinen dafür zu kämpfen, dass sich die Dinge ändern, anderen scheint alles egal zu sein. Mal frustriert, mal zugedröhnt, lässt Aki sich mehr oder weniger ziellos durch die Straßen, diverse Clubs und Partys treiben oder im rasenden Porsche reicher Freunde durch die Stadt.
Aki selbst ist nicht mit Luxusgütern ausgestattet, in seiner Wohnung ist es immer kalt, und auch sonst ist es dort nicht übermäßig einladend. Zudem steht er recht alleine da. Ein warmes Nest hat er nie gekannt, seine Familie hat ungefähr so gut funktioniert wie jetzt die Therme. Die Eltern sind aus Akis Leben verschwunden. Geblieben sind Freunde mit viel Geld und wenig Illusionen wie Albert (Porsche, großes Haus, viele Partys) oder noch mehr wie Timotheus (ein Alter Ego des Autors?), den Aki noch aus seiner Zeit in München kennt (wo auch der Autor gelebt hat).
Anklänge an biographische Stationen des Autors durchziehen den Roman, explizit und implizit. Da ist etwa die Werbeszene: Timotheus Ueberall hat als Werbetexter gearbeitet, er kennt die suggestive Kraft von Sprache und Inszenierung, von bestimmten Formen der Erzählung, der Perspektivierung von Tatsachen bis hin zur Verdrehung. Manipulation aller Art, von innen und von außen und die Schwierigkeit, Dinge zu verstehen, ohne sich an der Nase herumführen zu lassen (von eigenen Zwängen oder solchen von außen) sind zentrale Motive im Roman. Die Medienwelt ebenfalls. Aki sitzt viel allein zu Hause herum, hört klassische Musik, schaut Nachrichten, schüttet dabei ein paar Flaschen Wein in sich hinein und auch sonst noch allerhand. In seinem Kopf läuft Dauerfernsehen, am Laptop auch. Nicht selten sind es Horrormeldungen.
Der Zustand der Welt ist nicht gut. Akis Zustand auch nicht. Dünn und bleich ist er, oft kurz davor, zusammenzuklappen. Und dann lernt er Nina kennen. Sie ist älter als Aki, kennt die Welt und ihre Zustände also schon ein wenig länger – und scheint viel besser mit ihnen zurechtzukommen als Aki (was aber wohl für die meisten Menschen gilt). Eine Art Ersatzmutter ist Nina aber nicht. Sie braucht ihre Freiheit und weiß, was sie will (z. B. Sex, nicht nur mit Aki, aber auch). Sie gewinnt Aki lieb, auf ihre Weise. Er sie auch. Trotzdem schafft er es nicht, sie wirklich an sich heranzulassen, jedenfalls nicht immer. Schnell wird ihm Nähe zu viel, und dann stößt er Nina weg und vor den Kopf. Aki scheint permanent vor etwas zu fliehen, etwas zu verdrängen, seien das nun desillusionierende Einsichten in den Zustand der Gesellschaft, die ersten Anzeichen einer beginnenden Beziehung mit Nina – oder schlicht das Leben. Letzteres holt ihn dann doch immer wieder ein, wenn auch vor allem in Form der Vergangenheit oder durch Nachrichten und Reportagen. Aki erträgt es mit Wein und anderen Drogen. Wahrnehmungsfilter aller Art sind willkommen, um nicht sehen zu müssen, was man nicht sehen will. Es wird allerhand geschluckt und geschnupft in diesem Roman – und gekotzt.
Zu Akis Antriebslosigkeit gesellt sich schließlich auch noch das Gefühl, verfolgt zu werden. Wer die sind, die hinter ihm her sind, ist nicht ganz klar, Außenwelt und Einbildung verschwimmen allmählich; manchmal ist Aki nicht ganz sicher, was er tatsächlich getan hat und was nichts weiter ist als ein dumpfes Gefühl. Rund um ihn geschieht ohnehin Befremdliches, und so versinkt er tiefer und tiefer in Paranoia und Psychosen. Für andere wird es zusehends schwieriger, zu Aki durchzudringen. Das gilt auch für Nina.
Akis psychischer Zustand passt gut zur Kulisse des Romans, einem Wien in Endzeitstimmung: Während Klimaaktivist:innen unter dem Label „Letzte Chance“ demonstrieren, schwelen soziale Unruhen. Die Stadt dreht durch, Polizeisirenen, Prügeleien, Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Überall wird demonstriert und rechtsradikale Gruppen schleusen sich in die anderen Protestbewegungen ein, es brennen Geschäfte und Bankfilialen. Die Menschheit als solches agiert nicht viel weniger selbstzerstörerisch als der ständig zugedröhnte Aki, nach dem Motto: Wir wissen, dass etwas nicht gut ist, aber wir tun es trotzdem, wenn es sich für einen Moment gut anfühlt. Wir wissen auch, was gut wäre, aber wir tun es trotzdem nicht. Weil uns die Kraft dazu fehlt, weil es so viele Interessen gibt, die gegeneinanderstehen, kurz: weil es kompliziert ist.
Crazyland, das ist die Welt im Kopf und im Drogenrausch, in der Paranoia, der Psychose – und im Alltagswahn. Crazyland, das ist aber auch die Ungereimtheit überall da draußen, die Manipulation der Massen, mal in diese, mal in jene Richtung, mal von jenem Konzern, mal von diesen Algorithmen, von jener Story oder dieser Lüge. Muss man den Durchblick haben, um Demokratie zu leben? Was braucht es, um überhaupt zu leben? Aki ist nicht die Art Figur, die Antworten auf solche Fragen finden würde. Und Crazyland ist ohnehin kein Roman über Selbstfindung – eher einer über den Verlust des Selbst im Durcheinander der Umgebung.
Die Welt (im Kopf) zerfällt, die Sprache wird zu leeren Worthülsen und erschöpft sich in Kalauern. Aki und seine Freunde geben sich zumeist abgeklärt, kommentieren, wie verblendet die anderen sind, wie naiv. Sinnlos ist alles – und vor allem das, was andere tun. Der eigene Kopf fällt zumindest auf Werbesprüche nicht herein … statt dessen steckt er in seinem eigenen Sand, voll von chemischen Substanzen aller Art. Es ist nicht einfach zu durchschauen, wie die Welt da draußen tickt. Und die Welt im Kopf – ist auch ein Mysterium.
In der Rezeption des Romans wurde mehrfach auf Parallelen zu Christian Krachts Faserland hingewiesen. Kein Wunder, lässt sich doch schon der Titel als Anspielung lesen, und auch einige andere Aspekte finden sich wieder, vom reichen Freund mit Porsche über die Ziellosigkeit, mit der sich die (großteils männlichen) Protagonisten durch die Welt und allerhand Räusche und Facetten der Konsumgesellschaft treiben lassen – bis hin zu ihrer Neigung zum Kotzen. Während das alles bei Kracht aber vergleichsweise behütet vor der Kulisse einer gewissen saturierten Oberflächlichkeit abläuft (man wacht irgendwo verkatert auf und erinnert sich an ein paar Peinlichkeiten; wirkliche Schicksalsschläge treffen allenfalls andere), gehen bei Ueberall tiefe Risse durch Psyche und Gesellschaft, und in den Medien sind Krieg und Umweltkatastrophen bereits weitaus präsenter als Markenwerbung.
Wer Crazyland als eine Art Fortsetzung oder Hommage auf Faserland lesen will, findet hier nun sozusagen nach dem Satyrspiel eine Tragödie. ,Cool‘ über den Dingen zu stehen klappt nicht mehr so recht in einer zusehends von Krisen gebeutelten Zeit. In diesem Sinne gewinnt auch Akis Paranoia Symbolgehalt: Je mehr er sich abkapselt, desto mehr drängt sich das Außen in sein Inneres. Keine Droge und keine Idee schützt auf Dauer vor der Wirklichkeit. Es ist also höchste Zeit, sich ihr zu stellen.
Sabine Dengscherz, geb. 1973 in OÖ, Schreibwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Universitätslektorin. Studium der Germanistik, Kommunikationswissenschaft und Hungarologie, Venia für Transkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeit. Forschung zu Schreibprozessen, Schreibstrategien und Kulturbegriffen. Mitglied in der GAV, im ÖSV und im Literaturkreis Podium. Lebt in Wien und Dénesfa. www.dengscherz.at