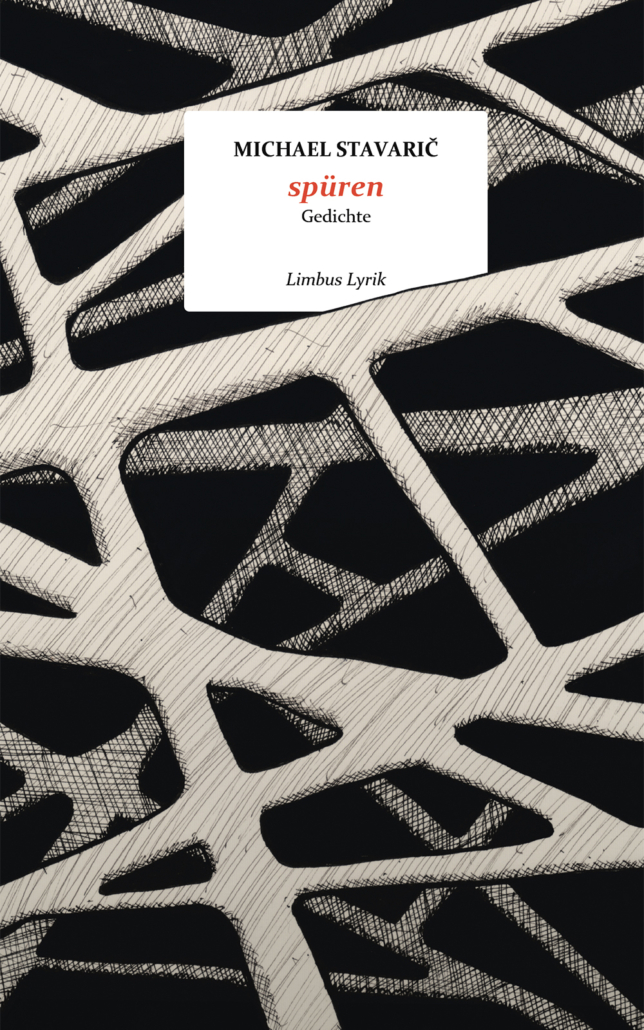Michael Stavaričs Langgedicht spüren entfaltet eine literarische Topographie der Empfindungen, in deren Zentrum der wiederkehrende Anfangssatz „ich spüre“ steht. Dieses komplexe Gewebe aus einzelnen Gedichten konstituiert sich nicht linear, sondern als emotionale Kaskade, die von der unmittelbaren menschlichen Wahrnehmung bis ins Übernatürliche reicht. Geprägt von einer inneren Getriebenheit, offenbart sich in diesem breiten Spektrum eine Ambivalenz, die von sentimental-schönen Bildern bis hin zu überhöhten, mitunter humorvollen, Zerrbildern reicht. Bereits die ersten Verse evozieren diese Grundspannung des Werkes durch die Gegenüberstellung von Zartheit und roher Gewalt: „ich spüre Regen auf der Haut / mit der Sanftheit von Planierraupen“ (S. 5).
Dieses Spüren, das Stavarič fast rituell beschwört, reicht bis in Bereiche, die üblicherweise der rein physischen Wahrnehmung entzogen sind. So nimmt das lyrische Ich beispielsweise die Gedanken „zerknüllte[r] Blätter“ wahr, die ihm störend in die Quere kommen (S. 18). An anderer Stelle geht dieses Spüren ins Kosmische über: „ich spüre die Orientierungslosigkeit / von Kometen denen für gewöhnlich / Rastlosigkeit nachgesagt wird / jener vorsätzliche Unruhezustand / der sich unweigerlich eines / jeden Reisenden bemächtigt / wenn er zu lange in gewohnten Bahnen / unterwegs ist“ (S. 45).
Die repetitive Struktur des Bandes mit dem wiederkehrenden Wort „spüren“ fungiert auch als affirmative Bekräftigung des lyrischen Ichs – eine existenzielle Verankerung, die an Descartes’ „Ich denke, also bin ich“ erinnert. Durch diesen wiederholenden Akt des Spürens und der sprachlichen Artikulation wird die subjektive Empfindung zur zentralen Erfahrung und gleichzeitig zu einem notwendigen Reflex, um das eigene Selbst in Relation zur Welt zu setzen.
Diese Notwendigkeit des Ausdrucks kulminiert in der Erkenntnis: „ich spüre dass man das Leben / nicht auf ein Stück Papier bannen kann / dass ein Körper zum Körper drängt / alles sei nur eine Frage des Augenblicks / sagst du und lachst und weinst / über die Größe des Universums“ (S. 61). Der Augenblick erweist sich somit als zentrales narratives und strukturelles Element des Gedichts – dessen Endgültigkeit das lyrische Ich durch das Schreiben jedoch aufheben will.
Die einzelnen Gedichte formen ein assoziatives Geflecht, das an einen Nestbau erinnert: Das lyrische Ich springt von Thema zu Thema, im Bestreben, sich metaphorische Schutzräume zu schaffen – selbst, wenn dies nicht immer gelingt, wie bei den „Humpelvögel[n] […] welche mit Krüppelbeinchen / fransige Ornamente im Staub / hinterlassen“, für die das lyrische Ich Empathie empfindet (S. 19). Dennoch unternimmt das lyrische Ich immer wieder Versuche der Verortung, etwa durch die präzise Fixierung geografischer Koordinaten: „wie der Andromedanebel der nichts / mit der Milchstraße am Hut hat und / der sich über den Mount Andromeda / zu legen pflegt auf den / Südlichen Sandwichinseln / 57° 5‘ 59‘‘ S, 26° 41‘ 57‘‘ W“ (S. 66).
Schließlich bleibt einzig die wiederkehrende Thematik des Spürens, die als roter Faden fungiert, der vom unmittelbaren Akt der Wahrnehmung zu einer intensiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gefühlszuständen führt und aus denen der Autor ein Nest spinnt, das man als Überbau wahrnimmt. Dieses Prinzip spiegelt auch die menschliche Grunderfahrung wider: das Streben nach Verbindung, Erkenntnis und Selbstvergewisserung, das in der überreizten Welt jedoch oft dem Scheitern anheimfällt.
Stavarič setzt darüber hinaus bewusst intertextuelle und popkulturelle Referenzen ein, um den einzelnen Gedichten einen weiteren Unterbau und somit Halt zu geben. Er erschafft Neologismen und bringt durch Verwendung englischer Wörter jene Grenzen zwischen Sprachen und Kulturen zum Verschwimmen, die die heutige Gesellschaft und die Weltvernetzung evoziert. Dies unterstreicht die Idee eines sich permanent im Fluss befindlichen Selbst- und Weltbildes – ein Bild des unruhigen Suchens und des temporären Einnistens in einer fragilen sich stetig verändernden/entwickelnden Welt.
spüren fordert die Leser:innen heraus, sich auf eine körperliche Erfahrung einzulassen – wenn im „Bonustrack“ das (Mit)Spüren geradezu eingefordert wird: „spürt das von den Bergen / hin und her geworfene Echo / spürt immer weiter“ (S. 94). In dieser Verbindung von Körperlichkeit und Gefühl lässt sich in spüren auch eine subtile Gesellschaftskritik erkennen: die Auseinandersetzung mit einer zunehmenden Empathielosigkeit und der Zerbrechlichkeit unserer inneren Gefühlwelt/unseres Gefühlszustands. Durch die Vielstimmigkeit der einzelnen Gedichte zeichnet Stavarič ein Kaleidoskop menschlicher Emotionen – ein poetisches Spiegel- und Zerrbild unserer Zeit zwischen Empfindsamkeit und Desillusionierung.