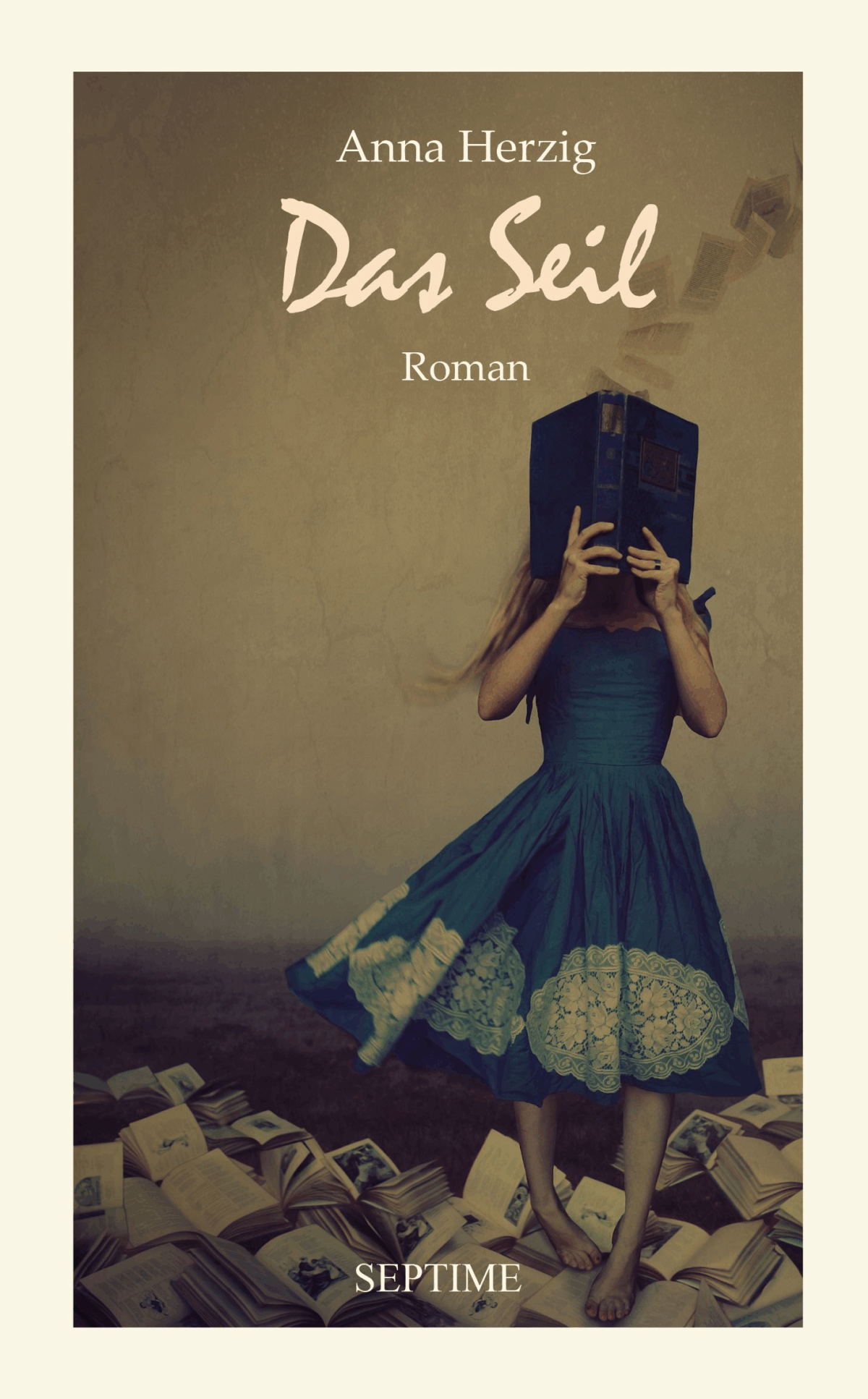Anna Herzig widmet ihren vierten Roman Das Seil allen, „die eine schwere Kindheit überlebt haben“ (S. 5). Ihre Protagonistin Franziska Großhirsch hat die ihre durch eine Verkleidung als Schutz gegen die Schwere der Realität überlebt. Doch nun hat sie einen Literaturpreis gewonnen und es „besteht dringender Handlungsbedarf. Franziska gibt alles, damit ihre Verkleidung bereit ist, um sich für immer darin verstecken zu können“ (S. 22). Denn zum einen muss sie den Preis im Rahmen einer Verleihung öffentlich entgegennehmen. Zum anderen hat sie mit einem Text gewonnen, der von ihrer schweren Kindheit handelt: Nach dem Tod ihres geliebten Großvaters Walter Werner, einem Schriftsteller, kommt Franziska als Siebenjährige zu ihrer Tante Hilde. Diese hat sie schon vor ihrem Umzug nicht geliebt, aber erst in deren Wohnung lernt sie sie wirklich kennen und fürchten: „Man sieht es ihr nicht an, aber wenn sie wütend wird, wächst aus der Tante noch ein zweites Monster heraus, das sich nicht mehr beruhigen lässt. Eines, noch unverzeihlicher als die Tante selbst.“ (S. 24) Um die Gewalt zu ertragen, legt Franziska die Verkleidung an.
Auf der Gegenwartsebene hat Franziska sich schon seit zwei Tagen in ihrer Wohnung verbarrikadiert, um diese, ihre Verkleidung für die Preisverleihung in Ruhe auszubessern, zu verstärken. Sie ignoriert Anrufe von Verwandten, ihrem Exfreund und ihrer Agentin. Es hilft nicht. Tante Hilde taucht auf, um einen Teil des Preisgeldes einzufordern, hämmert gegen die Tür, kampiert vor dem Wohnhaus. Und die Furcht vor der Zukunft und der Preisverleihung und auch die Erinnerungen lassen sich ebenfalls nicht aufhalten. Alles dringt auf Franziska ein, wird ihr zu viel. Zunehmend wird ihre Verkleidung fadenscheinig, ist nicht mehr zu flicken: „Es macht keinen Unterschied, wie viel Zeit zwischen damals und heute vergangen ist, denn dieses Kind liegt ständig auf der Lauer, schon lange Zeit eins geworden mit seiner realitätsresistenten Verkleidung.“ (S. 27)
Formensprache
Dieses „Einssein“ zeigt sich auch im Textbild. Es gibt keine Anführungszeichen, sehr selten ist etwas kursiv gesetzt, die Kapitel sind erst gegen Ende nummeriert, beginnen davor mit einer Initiale. Nichts wird also hervorgehoben, Franziskas Gegenwart und Vergangenheit sind einander vom Textbild gleich und beide werden im Präsens erzählt.
Ein auffälliges Element auf der Wortebene taucht bereits in der Widmung auf und hängt womöglich damit zusammen, wie Franziska und ihr lernschwacher Cousin Martin mit der Gewalt ihrer Tante, seiner Mutter umgehen. Oft werden nämlich bestimmte Worte dreimal wiederholt. „Für alle, die dieses Buch lesen, lesen, lesen“ (S. 5), heißt es etwa in der Widmung. Oder als das Telefon wiederholt läutet und Franziska nicht abhebt, sondern „atmet, atmet, atmet“ (S. 11). Wenig später denkt sie an die Preisverleihung und „trinkt, trinkt, trinkt“ (S. 13) einen „Becher Schlagsahne“.
Obwohl die Wiederholungen nicht von Figuren in direkter Rede geäußert werden, Herzig in dritter Person erzählt, könnte es sich dabei um sogenanntes Stimming handeln, selbststimulierendes Verhalten in Form von wiederholten Lauten oder Handlungen, was beruhigen soll. Auch Martin zeigt dieses Verhalten. Als Hilde Franziska schlägt, schreit er etwa: „Aua.Aua.Aua!“ (S. 14)
Für Franziska führt in der Gegenwart ihrer verbarrikadierten Wohnung aber weder das bewusste Atmen noch das Trinken der Sahne zur Beruhigung. Doch zumindest der Text beruhigt sich in jener Hinsicht, dass Herzig die Gewalt gegen die Kinder nie ausbeutet. Das Schlimmste deutet sie nur an. Etwa, was Tante Hilde mit Martin in einem versperrten Raum, mit erwachsenen Besuchern und einer Kamera macht. Auch Gewalt gegen Erwachsene wird nur angedeutet. Etwa mit dem visuell markantesten Element des gesamten Textes: einem ganzseitigen leeren schwarzen Rahmen, gleich einem Trauerbrief auf Seite sechzig, genau in der Mitte des Buches. Den Inhalt kann man sich nach dem vorangehenden Kapitel denken. Herzig muss es nicht ausschreiben. Die Vorstellung ist schlimm genug und beängstigt Franziska zunehmend. Denn schon zu Beginn hat sich jemand bei ihr gemeldet, der bereits seit zwanzig Jahren tot ist: „Alles wird gut, sagt der Großvater, mein Afferl, ich bin bei dir.“ (S. 12) Aber ist das auch bloß eine Vorstellung oder doch mehr?
Der Text als Matrjoschka
Zur gegenwärtigen Handlung in Franziskas Wohnung und ihrer Vergangenheit kommt mit der Wiederauferstehung des Großvaters jedenfalls eine dritte, fantastische Ebene hinzu. Auf der Oberfläche der Textebene gleichen diese „Großvater“-Kapitel den beiden anderen Erzählsträngen. Inhaltlich bringt Herzig in ihnen aber das titelgebende Seil ins Spiel: Eine Person, deren Existenz nie verraten wird, wirft ein Seil in den Inn, an dem der Großvater wieder in die Welt, die Gegenwart kommt. Anfangs weiß er nur: Er „hat geliebt“ (S. 21). Etwas später fühlt er „sich wie ein bockiges Puzzleteil, das nirgends reingedrückt werden kann“ (S. 43). Da findet er eine Zeitung mit einem Bericht über den Literaturpreis und weiß, in „drei Tagen wird er einen Preis erhalten. Den ersten seines Lebens. Dorthin gilt es zu kriechen, quer durch die Bundesländer“ (S. 44). Schließlich liest er „einen vertrauten Namen unter einem Teilabdruck des Siegertextes, aber es will sich nicht so recht einstellen, was dieser Name für ihn bedeutet.“ (S. 44)
Was hier angedeutet wird, löst Herzig einige Seiten weiter auf. Franziska hat die siegreiche Erzählung nicht geschrieben, es ist der „Text des Großvaters“ (S. 53). Wurde der Großvater vielleicht deshalb mit dem Seil von der:dem Unbekannten aus dem Inn geholt, damit er sich an Franziska für diesen Diebstahl rächt? Jener Mann, den sie so geliebt hat wie „ein paniertes Kalbsschnitzel auf einem Erdbeerfeld“ (S. 11)? Oder existiert der Wiederauferstandene wirklich nur in Franziskas Vorstellung? Oder vielleicht im siegreichen Text, der auch Das Seil heißt? Oder hat der:die Unbekannte den Großvater zurückgeholt, um Franziska zu helfen?
Herzig streut Zweifel, spielt geschickt mit Metafiktionalität, Autor:innenidentitäten und mit dem Rätselhaften. In den knappen Kapiteln schafft sie es nicht nur, die drei Generationen der Familie Großhirsch, ihre Liebe, ihren Hass schlüssig darzustellen, sondern wagt es auch, mit wenigen Sätzen die Schlüssigkeit wieder aufzubrechen, sie zu hinterfragen. Der Text wird so in einer spannenden Schwebe gehalten, in der alles möglich ist. Schließlich ist die Verarbeitung von Traumata nicht einfach. Warum sollte es dann seine literarische Bearbeitung sein?
Franziska versucht es zunächst und weiterhin mit Verdrängung, will sich weder mit der Vergangenheit noch der Gegenwart oder der Zukunft auseinandersetzen. Um die Geister, die Monster der Vergangenheit im Zaum zu halten, heißt es etwa lapidar, dass Franziska ihre drei Katzen im Badezimmer getötet habe. Doch trotz „der dargebrachten Opfer sind plötzlich Miniaturgroßväter aus einem quer verlaufenden Riss im Badezimmerspiegel gestiegen“ (S. 31). Sie „versucht, alle Großvatergeister einzufangen, um sie wieder in den Badezimmerspiegel zu stopfen, damit sie rübergehen auf die andere Seite, dort, wo sie hingehören“ (S. 53).
Ob Franziska damit Erfolg hat, ob sie ihren Widerstand aufgibt, aufgeben muss, wie die Preisverleihung abläuft, was der auferstandene Großvater vorhat und ob er wirklich der Autor der preisgekrönten Erzählung ist, soll hier nicht verraten werden. Es warten noch viele Überraschungen in diesem Buch, dessen Autorin Anna Herzig ist, von der es noch viele weitere Bücher geben sollte.
Florian Dietmaier wurde 1985 in Graz geboren und hat dort ein Germanistikstudium abgeschlossen. Literarische Publikationen in der Zeitschrift manuskripte, Rezensionen u. a. in der schreibkraft. manuskripte-Förderungspreis der Stadt Graz 2019. Im Frühjahr 2024 erschien sein Romandebüt Die Kompromisse im Grazer Droschl Verlag, das mit dem Peter-Rosegger-Literaturpreis des Landes Steiermark 2024 ausgezeichnet wurde.