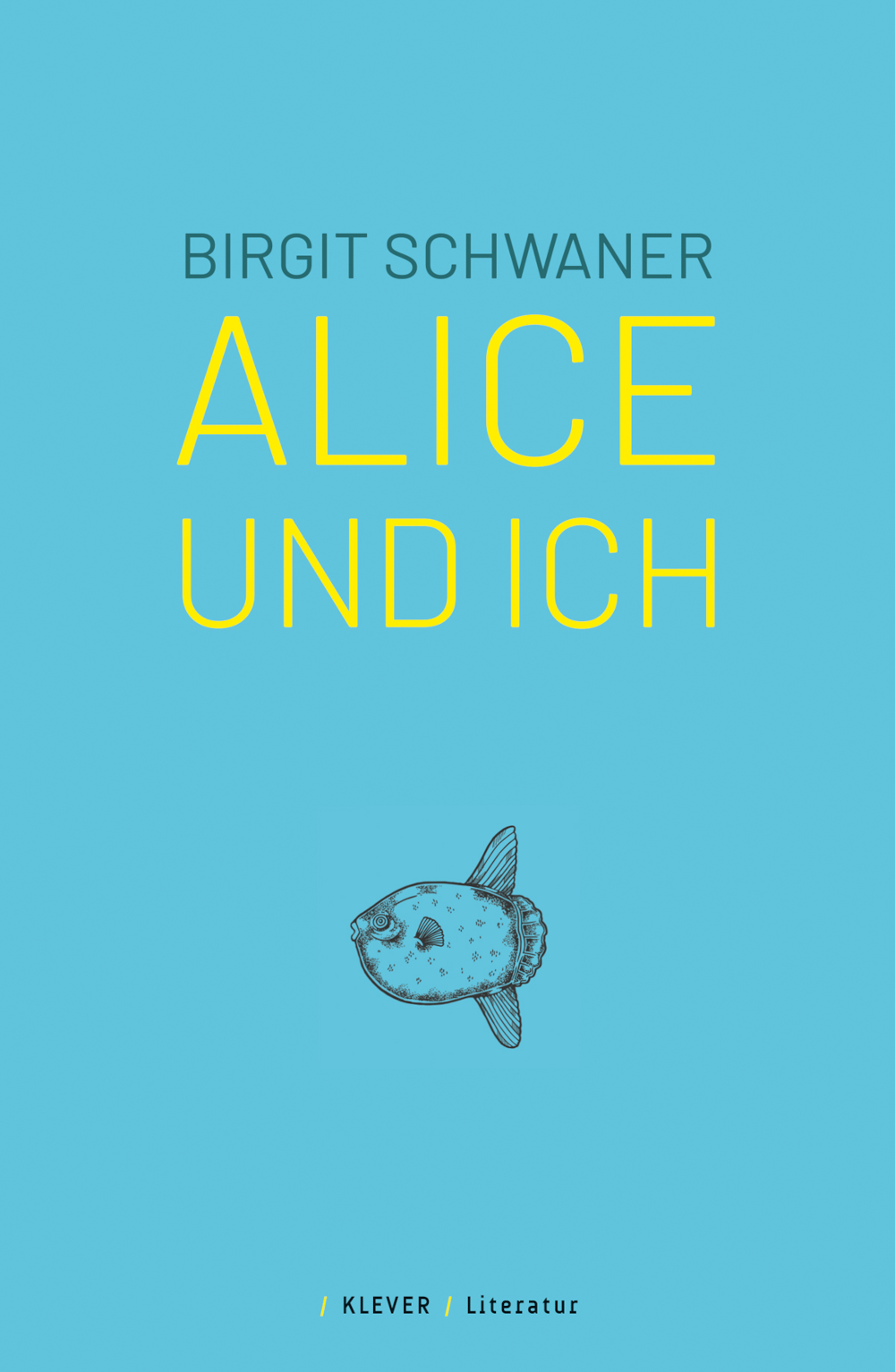Dem Buch vorangestellt ist zuerst ein Zitat des Surrealisten André Breton – „Im Absurden vermag der Geist einen Ausweg aus allen beliebigen Schwierigkeiten zu finden.“ (S. 5) – und dann die Anmerkung, dass es sich beim namentlich erwähnten Spital der Barmherzigen Brüder in Wien um einen fiktiven Mikrokosmos handelt. Im Kapitel „Vorab“ folgt noch der Hinweis, dass hinter dem Ich im Text noch ein weiteres Ich steckt: „Genaugenommen ist Ich die eine und die andere zugleich, während Alice die andere bleibt. […] Wir drei – Alice, das Ich und ich – stecken in der Geschichte fest.“ (S. 7)
Auch im Krankenzimmer, an dem die Geschichte an einem „29. Dezember“ einsetzt, sind es drei Betten bzw. Figuren: „Beim Eingang links noch drei Kleiderhaken für die Morgenmäntel der Damen, die rechterhand in den Betten hausen, eins, zwei, drei, aufgereiht, Besetzung wechselnd.“ (S. 10)
Von „30. Dezember“ bis „3. Januar“, wobei die einzelnen Tage als Kapitel fungieren, ist Alice eine der Zimmergenossinnen des erzählenden Ichs. Als Alice – gemeinsam mit einem Bildnis ihrer Schutzpatronin „Alice im Wunderland“ – das dritte Bett im Zimmer bezieht, scheint es ein Wink des Schicksals zu sein, liegt doch auf dem Nachtkästchen des Ichs das englische Kinderbuch Alice’s Adventures in Wonderland von Lewis Carroll.
„Wahr ist, Menschengesichter, in ihrer Schönheit, bleiben zerbrechlich. Was man mitunter vergessen will. Dann leuchtet eins wie vom Mond beschienen durch die Gegenwart, sag ich mal (hilflos), als käms aus einer Vergangenheit, einem alten Foto vielleicht, wär ausgeschnitten, ins Jetzt verschoben – wo sein Anblick einige Wenige an die verlorene Sehnsucht erinnert. So eins ist das Alice-Gesicht (wofür Alice freilich nichts kann), selbst ohne Augenbrauen und Wimpern und mit einem fast kahlen Kopf, worauf weißer Vögelchenflaum, möwenhell, noch auf Haare verweist. Babyhaare, Spinnwebfilz.“ (S. 23)
Alice ist nicht – wie das erzählende Ich – zum ersten Mal im Krankenhaus auf dieser Station „Gyn, Thema: der weibliche Unterleib, schambesetzte Zone noch immer, …“ (S. 58). Sie findet Halt im Absurden und Assoziativen der Sprache. So bezeichnet sie das Krankenhaus als Krakenhaus. Vom „Mahlzeit“ der Krankenschwester assoziiert sie weiter „Mahlzeit, Mahlstein, Mühlstein, oh Dear, Frühstück: Mühlstein und Spiegelei …“ (S.22) und hilft dem Ich damit den Mühlstein, der über ihr hängt, besser zu ertragen. Alice rät: „Traumkabel verbinden, im Gedächtnis Versprengtes finden, eine Sirenenmaschine baun.“ (S. 27)
Bei ihrem Schutzbildnis handelt es sich nämlich um ein Geschenk ihrer Mutter, die unter anderem mit den französischen Surrealisten verkehrte: Eine Tarotkarte, gezeichnet vom kubanischen Maler Wifredo Lam, die Alice (des Wunderlandes) als Sirene des Traums darstellt. Alice (im Krankenhaus) hält sich an die Devise „Traumlogik gegen Trauma“ (S. 60) und an die Technik des automatischen Schreibens. Mehr oder weniger manisch schreibt sie seitenweise in ihr grünes Notizbuch, schreibt gegen „die Vernebelung ihrer Sprache, ja, ihres Denkens“ (S. 73) an, welche als Nebenwirkung der Medikamente auftritt.
So beginnt auch Ich zu träumen und zu schreiben, während sich in wenigen Tagen der Verdacht auf Eierstockkrebs bestätigt und die Operation geplant wird: „Ist ja kein Geheimnis, was man aus einem Körper räumt, wenn ein Tumor nen Eierstock usurpiert mit Gefahr in Verzug – derlei könnt ihr auch googeln (#Ovarkarzinom)“ (S. 80).
Bei der Aufnahme zur Operation am „14. Januar“ ist Alice zwar auch wieder im Krankenhaus, allerdings in einem anderen Zimmer. Als Ich in der ersten Nacht nach der Operation kurz aufwacht, glaubt sie, Alice neben ihrem Bett zu sehen. „Ich schloss kurz die Augen, danach war sie fort, niemand wusste wohin.“ (S. 94) Übrig bleibt ein grünes Notizbuch, das aussieht wie das von Alice, und das Lachen des Ichs, mit dem es versucht, falsche Träume zu zersprengen.
Im Nachtrag erfahren wir zur Sirenenmaschine: „Es gibt keine andere Welt als diese, also muss man eine andere in dieser erschaffen.“ (S. 97)
Auf kaum hundert Seiten entwirft die Autorin mittels dieser Geschichte das dichte Bild eines Krankenhausalltags, der für das Ich keineswegs Alltag, sondern einen harten Einschnitt darstellt. Neben der Beziehung zu Alice werden in kurzen Szenen und mit wenigen Worten auch andere Patientinnen, Besucher:innen und Krankenhauspersonal plastisch geschildert. Die fragmentarische, collagierte Form passt ausgezeichnet zum Gefühlszustand des Ichs und zur Krankenhaussituation, in der Eintönigkeit neben Unberechenbarkeit der Ereignisse existiert.
Der Text ist eine äußerst originelle Auseinandersetzung mit der Frage, ob und wie Phantasie, Zufall, Sprache und Sprachreflexion sowie Humor uns in existentiell bedrohlichen Situationen zu retten vermögen. Nicht zuletzt verstehe ich ihn auch als Plädoyer für Solidarität und Freundschaft.
Barbara Rieger (* 1982) ist Autorin, Schreibpädagogin und Herausgeberin. https://www.barbara-rieger.at/